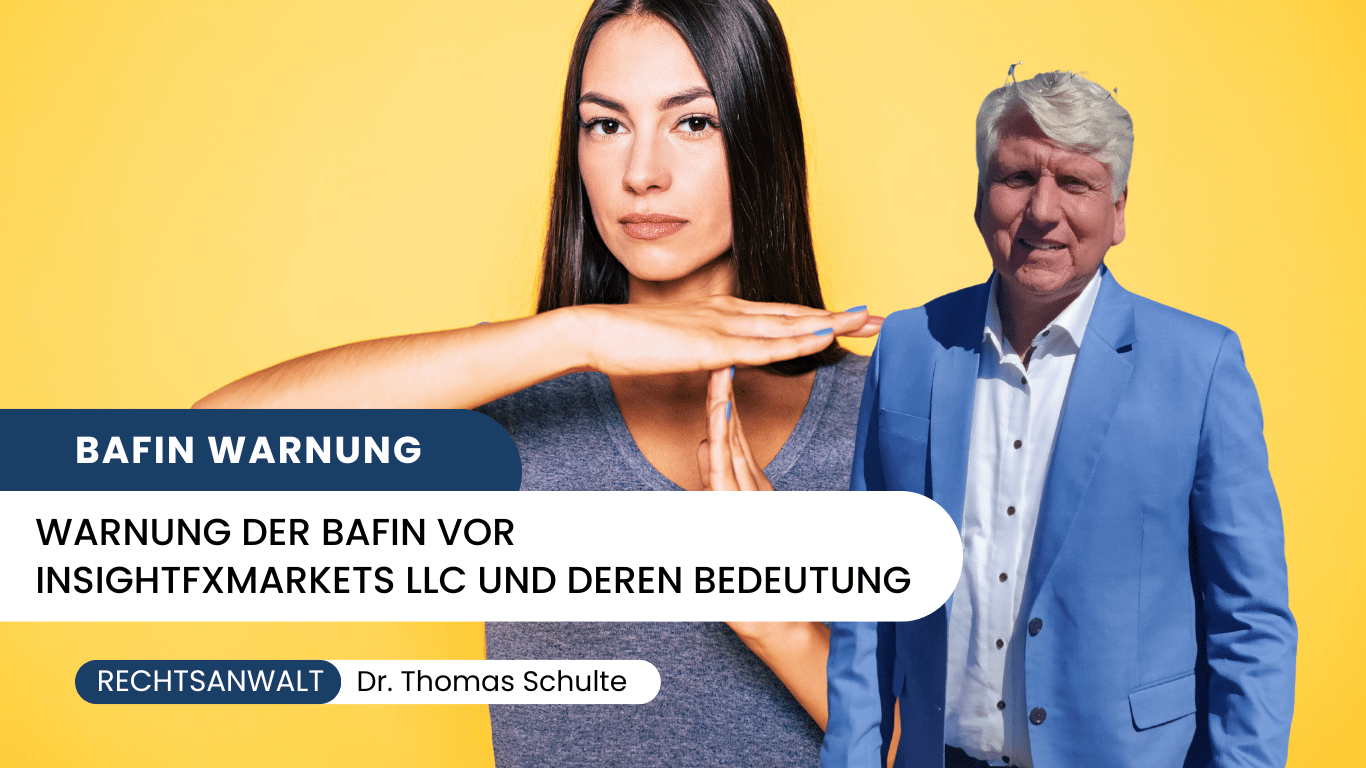Wenn Versicherungsbestände wandern – zwischen Regulierung, Vertrauen und Zukunftsfragen: Was bedeutet es, wenn Millionen von Versicherungsverträgen per Federstrich den Besitzer wechseln? Und welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus für Kunden, Unternehmen und den gesamten Markt?
Die Konsolidierung im deutschen Versicherungssektor schreitet in hohem Tempo voran. Allein im Jahr 2024 wurden nach Angaben der BaFin Bestände mit einem Prämienvolumen von über 40 Milliarden Euro übertragen – Tendenz steigend. Besonders ins Blickfeld geriet nun die Übertragung eines Teilbestands der AGER Lebensversicherung AG auf die AXA Lebensversicherung AG, die mit Verfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 5. August 2025 genehmigt und nur drei Tage später, am 8. August 2025, rechtswirksam wurde. Hinter solchen Zahlen stehen jedoch keine abstrakten Vorgänge, sondern Millionen betroffener Versicherungsnehmer, deren Verträge, Leistungen und Zukunftssicherheit unmittelbar berührt werden.
„Die Bestandsübertragung ist kein technischer Verwaltungsakt, sondern ein fundamentaler Eingriff in Kundenbeziehungen, Kapitalflüsse und Vertrauen“, erklärt Sven Enger, ehemaliger Vorstand verschiedener Versicherungsunternehmen und heute Geschäftsführer der auxinum GmbH. Für Juristen wie Dr. Thomas Schulte aus Berlin ist die Brisanz ebenso deutlich: „Wir bewegen uns in einem Feld, in dem § 13 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) zwar den Rahmen vorgibt, die praktische Umsetzung aber stets Fragen nach Transparenz, Rechtssicherheit und Verbraucherschutz aufwirft.“
Die aktuelle Genehmigung wirft damit nicht nur wirtschaftliche, sondern auch tiefgehende rechtliche Fragen auf: Wie lässt sich sicherstellen, dass Verbraucherrechte gewahrt bleiben? Welche Prüfmechanismen hat die BaFin tatsächlich angewendet? Und: Reicht der bestehende rechtliche Rahmen aus, um das Vertrauen der Versicherten langfristig zu sichern – oder braucht es neue Standards für eine Zeit, in der Bestandsübertragungen fast zur Regel werden?
Rechtliche Einordnung und wirtschaftliche Dimension
Grundlage für jede Bestandsübertragung bildet § 13 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Diese Norm ist ein zentrales Instrument des Aufsichtsrechts: Sie erlaubt es Versicherern, Verträge oder ganze Vertragsportfolios auf ein anderes Unternehmen zu übertragen, sofern die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Genehmigung erteilt. Dahinter steckt ein doppelter Prüfauftrag: Zum einen muss das übernehmende Versicherungsunternehmen die ökonomische Stabilität und organisatorische Kapazität nachweisen, zum anderen wird die Einhaltung der Verbraucherrechte sichergestellt.
Gerade in Zeiten zunehmender Konsolidierung ist diese Aufsichtspraxis keine Formsache. Laut BaFin wurden allein 2023 Versicherungsbestände im Umfang von über 50 Mrd. Euro an Prämienvolumen übertragen – ein Höchstwert, der die Relevanz des Themas unterstreicht. Die Übertragung des AGER-Teilbestands an die AXA Lebensversicherung AG, die am 8. August 2025 mit Zugang der Genehmigungsurkunde wirksam wurde, ist damit kein Einzelfall, sondern Teil eines klaren Branchentrends.
Für Juristen wie Dr. Thomas Schulte stellt sich daher die zentrale Frage: Wie weit reicht die Schutzwirkung des VAG tatsächlich? Reicht die BaFin-Prüfung aus, um Verbrauchern dauerhaft Sicherheit zu geben – oder müsste die europäische Dimension stärker einbezogen werden, da viele Übertragungen grenzüberschreitend erfolgen? Hier zeigt sich, dass § 13 VAG zwar den rechtlichen Rahmen bildet, die praktische Umsetzung aber ständige Neubewertung erfordert, gerade in einer Branche, in der langfristige Verträge und Vertrauen die Währung schlechthin sind.

Sven Enger, ehemaliger Vorstand mehrerer Versicherungsunternehmen und heutiger Geschäftsführer der auxinum GmbH, bringt es auf den Punkt: „Eine Bestandsübertragung ist mehr als ein administrativer Akt – sie entscheidet über Stabilität, Vertrauen und Reputation ganzer Märkte.“ Er verweist auf die Praxis, dass gerade kleinere und spezialisierte Versicherer zunehmend Teile ihres Portfolios an große, kapitalstarke Gesellschaften wie AXA übertragen. Das schafft auf der einen Seite Sicherheit für Versicherungsnehmer, birgt aber zugleich die Gefahr einer zunehmenden Marktkonzentration, die Wettbewerb und Innovation einschränken könnte.
Doch Enger geht in seiner Kritik einen Schritt weiter: Wenn man die Perspektive radikal auf die Verbraucher richtet, muss man sich fragen, ob das Modell der klassischen Lebensversicherung überhaupt noch zeitgemäß ist. Jahrzehntelang galt sie als Eckpfeiler privater Altersvorsorge, doch angesichts von Niedrigzinsen, steigender Inflation und der Unübersichtlichkeit mancher Vertragsmodelle fühlen sich viele Versicherte eher als Spielball der Kapitalinteressen denn als geschützte Vertragspartner. „Müsste die Lebensversicherung nicht längst neu gedacht werden – weg vom reinen Bilanzobjekt der Gesellschaften hin zu einem transparenten, flexiblen Produkt, das tatsächlich die Lebensrealität der Versicherten abbildet?“, so Enger provokant.
Gerade diese Grundsatzfrage erklärt, weshalb er den Seitenwechsel vollzogen hat: weg vom Vorstandsposten aufseiten der Gesellschaften hin zum klaren Eintreten für die Verbraucher. Für ihn steht nicht mehr die Verwaltung von Portfolios im Vordergrund, sondern die Verteidigung von Vertrauen und Fairness im Versicherungswesen. „Es geht nicht nur darum, Bestände sauber zu übertragen – es geht darum, ob das ganze Modell noch den Menschen dient, für die es ursprünglich geschaffen wurde.“
Schutz der Versicherungsnehmer im Fokus
Zentrale Zielsetzung des Gesetzgebers bei einer solchen Übertragung ist der Schutz der Kunden, deren Versicherungsverhältnisse Gegenstand des Vorgangs sind. Vor dem Hintergrund des Art. 20 Abs. 1 VAG ist sicherzustellen, dass die Rechte, Pflichten und vertraglichen Abreden für die Versicherten durch die Bestandsübertragung unberührt bleiben. Das bedeutet, dass die genauen Inhalte der Verträge, insbesondere Versicherungssummen, Prämienstrukturen und Leistungsversprechen, nicht verändert werden dürfen. Ebenso dürfen durch den neuen Vertragspartner – also das übernehmende Versicherungsunternehmen – keine einseitigen Änderungen vorgenommen werden.
Nach herrschender Meinung in der juristischen Literatur und der Rechtsprechung hat der Versicherungsnehmer keinerlei Mitspracherecht im Rahmen der Übertragung. Er wird nicht Vertragspartner eines neuen Vertrags, sondern der bestehende Vertrag lebt rechtlich betrachtet mit dem neuen Versicherer weiter fort. Eine Veränderung tritt nur aufseiten des sogenannten Schuldners beziehungsweise Vertragspartners auf. Dies wurde auch in der bisherigen Entscheidungspraxis der BaFin mehrfach bestätigt.
Regulatorische Pflichten und Voraussetzungen
Für eine erfolgreiche Umsetzung einer solchen Übertragung sind zudem zahlreiche formelle und materielle Voraussetzungen notwendig. Gemäß § 13 Abs. 2 VAG verlangt die BaFin eine detaillierte Aufzeichnung über alle zu übertragenden Verträge, Kapitalwerte und Rückstellungen sowie eine Darstellung des geplanten Übergangsprozesses. Die Finanzmarktaufsicht legt besonderen Wert darauf, dass die Solvabilitätsquote des übernehmenden Unternehmens auch nach der Integration des Bestands nicht unter die gesetzlich geforderte Schwelle fällt.
Das übernehmende Versicherungsunternehmen – in diesem Fall die AXA Lebensversicherung AG – muss nachweisen, dass es über hinreichende personelle und technische Ressourcen verfügt, um den gestiegenen administrativen und vertraglichen Anforderungen gerecht zu werden. Auch ein lückenloses Berichtswesen und ein umfassender Datenübertragungsplan gehören zur Genehmigungsvoraussetzung.
Rechtsanwälte spielen in diesem Zusammenhang eine doppelte Rolle: Einerseits begleiten sie die transaktionsrechtlichen Aspekte – also Vertragsgestaltung, rechtliche Steuerung der Übertragung und Beratung beider Unternehmen im Hinblick auf mögliche Haftungsrisiken – andererseits sind sie auch Ansprechpartner für betroffene Versicherungsnehmer, die Informationen oder Rechtsbeistand benötigen.
Sven Enger, ehemaliger Vorstand mehrerer Versicherungsunternehmen und heutiger Geschäftsführer der auxinum GmbH, betont: „In der Praxis entscheidet weniger das juristische Rahmenwerk allein, sondern vielmehr die organisatorische und kommunikative Umsetzung über den Erfolg einer Bestandsübertragung. Versicherungsnehmer müssen Vertrauen haben, dass ihre Verträge nahtlos fortgeführt werden – ohne Leistungsverluste, ohne Informationsbrüche. Ein Unternehmen wie AXA muss daher beweisen, dass es nicht nur regulatorisch ‚fit‘ ist, sondern auch die emotionale Seite des Marktes versteht.“ Enger verweist darauf, dass gerade in einem Umfeld mit über 90 Millionen Lebensversicherungsverträgen in Deutschland das Vertrauen der Verbraucher die entscheidende Währung bleibt. Nur wenn Technik, Personal und Kommunikation reibungslos ineinandergreifen, werde eine Bestandsübertragung zum stabilisierenden Signal für den gesamten Markt.
Mehr als ein Einzelfall? – Bestandsübertragungen als Startschuss für neue Regulierungen in der Versicherungsbranche
Doch bleibt die Frage: Handelt es sich bei dieser genehmigten Bestandsübertragung nur um den Anfang? Oder erleben wir gerade die Vorboten einer Welle neuer Regulierungen in der Versicherungsbranche, die weit über einzelne Transaktionen hinausgehen werden? Denn während § 13 VAG die rechtliche Grundlage bildet, drängt sich aus Sicht vieler Experten die weiterführende Frage auf, ob es nicht einer gesamtheitlichen Regulierung bedarf, die Transparenz, Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz systematisch zusammenführt.
Sven Enger betont in diesem Zusammenhang: „Die Aufsicht darf nicht nur den technischen Vollzug überwachen, sondern muss auch die strategische Richtung der Branche im Blick behalten. Versicherungsunternehmen tragen eine enorme Verantwortung – nicht allein gegenüber den Aktionären, sondern vor allem gegenüber Millionen von Verbrauchern.“ Damit stellt sich die Herausforderung, ob Versicherer künftig nicht selbst zukunftsweisende Schritte einleiten müssen, um Vertrauen durch klare Kommunikation, transparente Strukturen und verbesserte Sicherheitsmechanismen zu schaffen.
Die gesellschaftliche Erwartung ist eindeutig: Verbraucher verlangen mehr Sicherheit, die Politik fordert bessere Aufsicht, und die Unternehmen stehen in der Pflicht, sich ihrer Verantwortung umfassend zu stellen. Ob die Bestandsübertragung zwischen AGER und AXA damit ein Einzelfall bleibt – oder ein Signal für eine breiter angelegte Regulierungsbewegung darstellt – wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen.
Doch gerade an diesem Punkt stellt sich die entscheidende Frage: Reicht es wirklich, nur bestehende Bestände zu übertragen und regulatorisch abzusichern? Oder müsste nicht vielmehr das gesamte Modell der Lebensversicherung neu gedacht werden, wenn man den Fokus ernsthaft auf die Versicherten legt? Jahrzehntelang diente die Lebensversicherung vor allem als Stabilitätsanker für Gesellschaften und Kapitalmärkte – doch für viele Kunden bleibt am Ende das Gefühl, dass sie hohe Beiträge zahlen, während Transparenz, Rendite und Flexibilität hinter den Erwartungen zurückbleiben. „Wenn wir Versicherungen nicht aus Sicht der Bilanzen, sondern aus Sicht der Verbraucher neu aufstellen, dann könnte ein modernes, transparentes und wirklich nutzerorientiertes Produkt entstehen“, mahnt Sven Enger.
Die Bestandsübertragung zwischen AGER und AXA ist deshalb nicht nur ein Verwaltungsvorgang, sondern ein Symbol: Sie zeigt, wie sehr sich die Branche zwischen regulatorischen Anforderungen, politischem Druck und wachsendem Verbrauchervertrauen neu erfinden muss. Vielleicht ist genau jetzt der Zeitpunkt gekommen, nicht nur über Aufsicht zu reden, sondern über die Grundsatzfrage: Dient die Lebensversicherung noch den Menschen – oder vor allem den Institutionen, die sie verwalten?

Zusammenspiel mit dem europäischen Aufsichtsrecht
Die Harmonisierung in der Europäischen Union beeinflusst das deutsche Versicherungsrecht signifikant. Der Schutz von Versicherungsnehmern ist nicht nur ein nationales Anliegen, sondern in den einschlägigen europäischen Richtlinien fest verankert. Die Solvency-II-Richtlinie etwa setzt europaweit einheitliche Standards für Eigenmittelanforderungen, Risikomanagement und Berichterstattung. Sie ist zentraler Bestandteil der aufsichtsrechtlichen Prüfungen durch europäische Behörden wie die EIOPA – gerade bei grenzüberschreitenden Bestandsübertragungen, wo Fragen der Stabilität und der Sicherung von Kundeninteressen besondere Brisanz erlangen.
Dr. Thomas Schulte ordnet diesen Kontext rechtlich ein: „Auch wenn wir es bei der Übertragung von AGER auf AXA mit einer innerstaatlichen Transaktion zu tun haben, müssen die deutschen Vorschriften stets im Lichte des europäischen Aufsichtsrahmens ausgelegt werden. Das bedeutet: nationale Praxis ja, aber stets eingebettet in den europäischen Integrationsgedanken.“ Schulte verweist dabei besonders auf den Datenschutz – ein Punkt, der in der Praxis häufig unterschätzt wird. Nach den Vorgaben der DSGVO (Art. 6 und Art. 9) muss jede Datenübermittlung auf einer klaren Rechtsgrundlage gestützt werden. Ein Verstoß kann nicht nur die Wirksamkeit einer Bestandsübertragung infrage stellen, sondern auch empfindliche Bußgelder nach sich ziehen.
Sven Enger, der als ehemaliger Vorstand mehrerer Versicherungsunternehmen die branchenspezifischen Herausforderungen kennt, ergänzt die wirtschaftliche Dimension: „Eine Bestandsübertragung ist nie nur ein administrativer Akt. Sie bedeutet für Versicherer einen tiefen Eingriff in die Organisation, die Prozesse und die Kundenbeziehungen. Wenn Datenübertragungen nicht sauber laufen oder Solvency-II-Kriterien nicht nachhaltig erfüllt werden, dann droht nicht nur regulatorischer Ärger, sondern auch ein erheblicher Reputationsschaden – und der wiegt in der Versicherungswirtschaft oftmals schwerer als ein formaler Verstoß.“
Beide Experten sehen daher in Bestandsübertragungen eine Art Prüfstein für die Zukunftsfähigkeit der Branche: Sie zeigen, wie ernst Versicherer und Aufsichtsbehörden ihre Verantwortung im Zusammenspiel von europäischem Recht, nationaler Praxis und Verbraucherschutz nehmen – und ob es gelingt, Transparenz und Sicherheit als gemeinsame Leitlinie durchzusetzen.
Praktische Relevanz für Versicherungsnehmer und Vermittler
Theoretisch gesehen sollte eine Bestandsübertragung spurlos am Versicherungsnehmer vorübergehen – der Vertrag bleibt bestehen, die zugesicherten Leistungen ändern sich nicht, und das aufsichtsrechtliche Verfahren soll reibungslos verlaufen. Praktisch jedoch zeigt sich ein anderes Bild: Für viele Versicherungsnehmer entstehen Unsicherheiten, die nicht selten in Unmut und Vertrauensverlust münden. Ob es um die Frage geht, ob künftig ein neuer Ansprechpartner zuständig ist, ob der Vertrag in seiner bisherigen Form unverändert weiterläuft oder wie sich eine Übertragung auf die Berechnung des Rückkaufswerts auswirkt – all dies sind typische Anliegen, die Rechtsanwälte wie Dr. Thomas Schulte in seiner täglichen Beratungspraxis erreichen.
Aus juristischer Sicht betont Schulte: „Viele Bestandsübertragungen sind formal korrekt, erfüllen die Anforderungen des § 13 VAG und bestehen die aufsichtsrechtliche Prüfung durch die BaFin. Doch die eigentliche Herausforderung liegt nicht im Gesetzestext, sondern in der Umsetzung – und insbesondere in der Kommunikation mit den Versicherten. Wenn der Kunde das Gefühl hat, nicht informiert oder gar übergangen worden zu sein, wird ein rechtlich einwandfreier Vorgang schnell zu einem Reputationsrisiko.“
Genau hier setzt die Einschätzung von Sven Enger an, der als ehemaliger Vorstand großer Versicherungsunternehmen die operative Seite kennt: „In der Praxis haben wir es oft erlebt: Die Technik funktioniert, die Verträge werden übertragen, aber der Kunde versteht nicht, was vorgefallen ist. Das Ergebnis ist Unsicherheit im Vertrieb, Stress für Vermittler und eine Flut an Rückfragen in den Servicecentern. Wer glaubt, dass ein Begleitschreiben mit juristisch-korrekter Sprache genügt, hat die Realität der Kundenkommunikation unterschätzt.“
Beide Experten plädieren deshalb für eine aktive und transparente Informationsstrategie. Ein rechtssicheres Verfahren allein reiche nicht aus – vielmehr müsse es begleitet werden durch klare, leicht verständliche Schreiben an die Versicherungsnehmer, ergänzt durch FAQs für Vermittler und digitale Informationsangebote. Nur so ließen sich Missverständnisse vermeiden, das Vertrauen der Kunden sichern und die Akzeptanz für solche Übertragungen stärken.
Dr. Schulte fasst es pointiert zusammen: „Juristisch korrekt – aber kommunikativ ein Desaster – so könnte man viele Bestandsübertragungen bezeichnen. Aufgabe der Branche ist es, beides zusammenzubringen: Rechtssicherheit und gelebte Transparenz.“
Digitalisierung und Zukunftsperspektiven
Ein zunehmend bedeutsames Element in der Versicherungsbranche ist die Digitalisierung – und sie verändert die Spielregeln tiefgreifend. Wo früher Aktenordner, Papierverträge und klassische Kundenanschreiben dominierten, treten heute digitale Vertragswerke, Self-Service-Portale und automatisierte Kommunikation in den Vordergrund. Für Bestandsübertragungen bedeutet das: Sie sind längst nicht mehr nur juristische und organisatorische Vorgänge, sondern zugleich komplexe IT-Projekte. Im Falle der AXA Lebensversicherung AG zeigt sich dies besonders deutlich: Die Integration neuer Bestandsdaten erfordert eine akribische Stammdatenpflege, die Sicherstellung funktionierender Schnittstellen zum Kundenservice sowie eine penible Einhaltung der IT-Compliance. Jede fehlerhafte Datenmigration kann nicht nur zu operativen Störungen führen, sondern birgt auch erhebliche rechtliche Risiken – von Datenschutzverletzungen bis hin zu Haftungsfragen.
Dr. Thomas Schulte hebt hervor: „Bestandsübertragungen bewegen sich längst im Spannungsfeld zwischen Recht und Technologie. Das Versicherungsaufsichtsrecht mag den Rahmen setzen, aber in der Praxis entscheidet die digitale Umsetzung darüber, ob ein Verfahren wirklich rechtssicher und kundenfreundlich ist.“ Genau an dieser Schnittstelle entstehen neue juristische Fragestellungen: Kann eine digitale Kontoaktivität des Kunden – etwa das bloße Einloggen in ein Online-Portal – als stillschweigende Zustimmung gewertet werden? Reicht eine E-Mail-Benachrichtigung über die Bestandsübertragung aus, um die rechtliche Informationspflicht zu erfüllen? Oder: Kann eine WhatsApp-Nachricht tatsächlich als wirksame Kündigungserklärung gelten, wenn sie vom Kunden eindeutig formuliert wurde?
Für Branchenkenner Sven Enger liegt darin die eigentliche Zukunftsfrage: „Versicherer müssen erkennen, dass digitale Kommunikation nicht nur ein Serviceinstrument ist, sondern auch Rechtswirkungen entfalten kann. Wer hier nicht rechtzeitig Standards setzt, läuft Gefahr, dass Gerichte und Aufsichtsbehörden im Streitfall Tatsachen schaffen – zum Nachteil der Unternehmen.“
Diese scheinbar trivialen Fragen sind alles andere als nebensächlich. Sie markieren vielmehr den Übergang zu einer neuen Ära des Versicherungsrechts, in der dogmatische Kenntnisse mit digitaler Versiertheit verbunden werden müssen. Die Versicherungswirtschaft steht damit vor der Aufgabe, nicht nur juristische Prinzipien wie Transparenz, Einwilligung und Informationspflicht umzusetzen, sondern sie gleichzeitig in digitale Prozesse zu übersetzen, die sowohl rechtswirksam als auch für Verbraucher verständlich und nachvollziehbar sind.
Fazit aus Sicht des Finanz- und Versicherungsrechts
Die Übertragung eines Versicherungsbestandes ist weit mehr als eine bilanzielle Transaktion oder ein rein technischer Verwaltungsakt. Sie ist ein Stresstest für das Vertrauen in die Versicherungswirtschaft und zugleich ein Prüfstein für die Wirksamkeit des deutschen und europäischen Aufsichtsrechts. Jeder Schritt – von der Prüfung der Solvabilität über die Einhaltung der DSGVO bis hin zur Kundenkommunikation – entscheidet darüber, ob Versicherungsnehmer sich geschützt fühlen oder ob Unsicherheit und Rechtsstreitigkeiten die Folge sind.
Dr. Thomas Schulte bringt es auf den Punkt: „Nur durch klare rechtliche Verhältnisse bleiben Versicherungsverträge langfristig verlässlich – Vertrauen in Versicherung ist Vertrauen in Recht.“ Genau dieser Gedanke darf nicht im Verwaltungsverfahren steckenbleiben, sondern muss sich in der Praxis widerspiegeln: Verbraucher erwarten Transparenz, Sicherheit und Fairness, gerade in Zeiten wachsender Digitalisierung und Marktverdichtung.
Auch Sven Enger warnt aus seiner Erfahrung in der Branche: „Wer Bestände übernimmt, übernimmt auch Verantwortung – nicht nur für Zahlen und Verträge, sondern für Menschen und deren Lebensplanungen.“ Damit wird deutlich: Jede Bestandsübertragung ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die über rein betriebswirtschaftliche Erwägungen hinausgeht.
Das Fazit lautet daher: Nur wenn Politik, Aufsichtsbehörden, Versicherer und Juristen an einem Strang ziehen, kann das System dauerhaft Vertrauen sichern. Die BaFin hat mit ihrer Genehmigungspraxis eine tragende Rolle, aber ohne aktive Kommunikation und klare juristische Begleitung bleibt das Risiko bestehen, dass Verbraucher sich im Dunkeln der Versicherungswelt verlieren.
Für die Zukunft gilt: Sicherheit ist kein Nebenprodukt – sie ist die Grundlage. Versicherungsverträge entfalten ihre Wirkung über Jahrzehnte, und nur ein rechtlich verlässliches, transparentes und zukunftsorientiertes Umfeld verhindert, dass aus einer rein formalen Übertragung ein Vertrauensverlust wird.
Schlussfolgerung: Die Lebensversicherung selbst muss neu gedacht werden – nicht als Produkt, das primär die Bilanzen von Gesellschaften stabilisiert, sondern als Instrument, das konsequent die Interessen der Versicherten in den Mittelpunkt stellt. Transparenz, Flexibilität und echte Verbraucherorientierung sind keine optionalen Zusatznutzen, sondern die Voraussetzung dafür, dass dieses Modell in einer modernen Gesellschaft überlebt. Ohne diese Neuausrichtung droht die Lebensversicherung, ihre ursprüngliche Funktion zu verlieren: Sicherheit für Menschen zu schaffen.
Autor: Maximilian Bausch, B.Sc. Wirtschaftsingenieur
Maximilian Bausch ist Wirtschaftsingenieur, Autor und Blogger. Er schreibt über Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie – faktenbasiert, verständlich und zukunftsorientiert.
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com