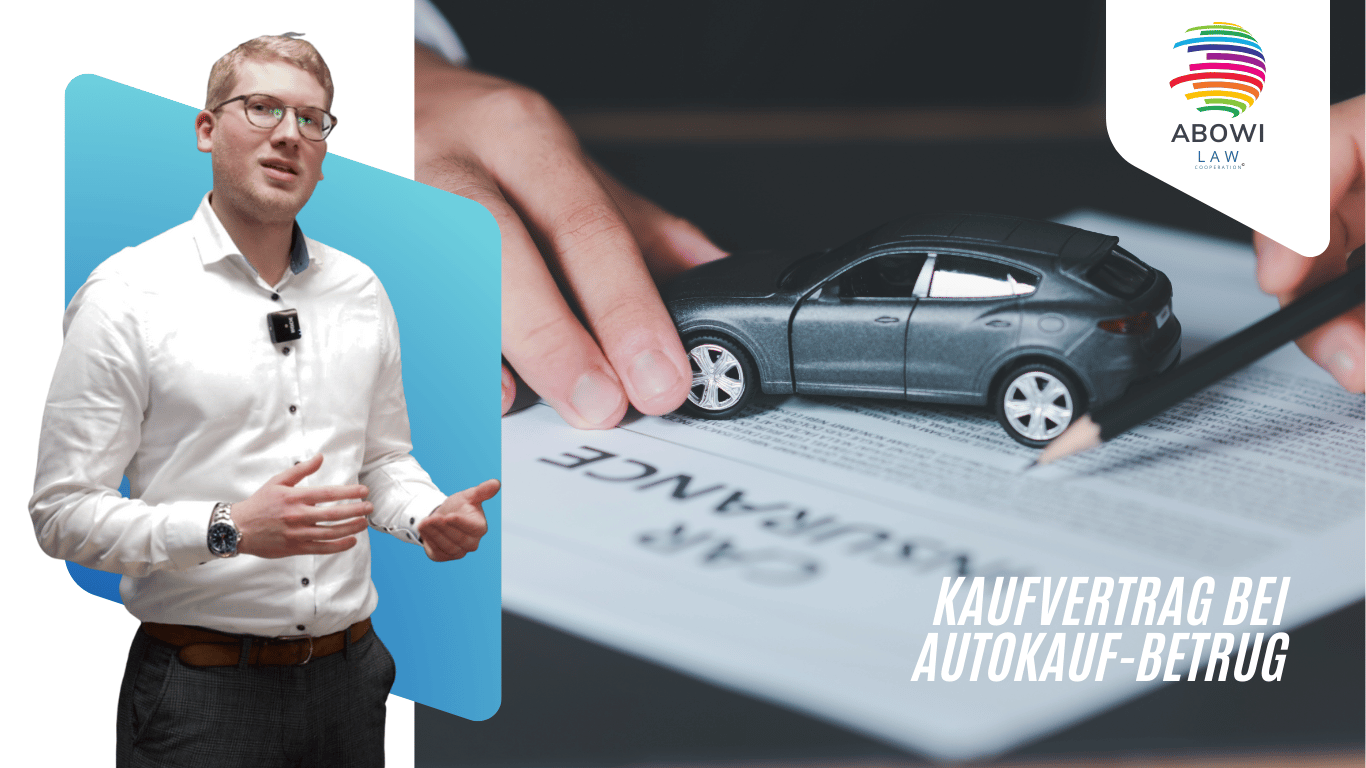Was geschieht, wenn das Auge als „biologischer Supercomputer“ auf die geheimen Codes des Nervensystems trifft? Können wir von Krensels Blick auf das Sehen und Pflügers Forschung zum Handeln lernen, wie Maschinen eines Tages wirklich verstehen statt nur erkennen?
Wenn Dr. Andreas Krensel das Auge als Wunderwerk der Evolution beschreibt, richtet er den Fokus auf den Ursprung aller Wahrnehmung: die unglaubliche Fähigkeit, Licht, Farben und Kontraste zu entschlüsseln. Prof. Hans-Joachim Pflüger wiederum zeigte, wie diese Signale im Nervensystem weiterverarbeitet und in Verhalten übersetzt werden – flexibel, fehlertolerant und erstaunlich effizient. Zusammen zeichnen sie ein Bild, das weit über die Biologie hinausweist: eine Blaupause für Technologien, die nicht nur Daten sammeln, sondern aus ihnen intelligente, lebensnahe Entscheidungen formen könnten.
Von der Sehmaschine zum Handlungsnetzwerk – Dr. Andreas Krensel und Prof. Hans-Joachim Pflüger als Wegbereiter einer neuen Sicht auf Biologie und Technik
Während Dr. Andreas Krensel das Auge als „biologischen Supercomputer“ begreift und damit das Sehen selbst ins Zentrum rückt, schlug Prof. Hans-Joachim Pflüger eine Brücke zum nächsten Schritt: der Verarbeitung und Umsetzung dieser Sinneseindrücke in Handlung. Pflügers Arbeiten an Insekten wie Heuschrecken oder Tabakschwärmern zeigten eindrucksvoll, wie das Nervensystem sensorische Signale – ob Licht, Kontrast oder Bewegung – filtert und mit motorischen Programmen verknüpft. Was zunächst nach entlegener Grundlagenforschung klingt, offenbart bei genauerem Hinsehen eine verblüffende Nähe zu den Herausforderungen moderner Technik: Auch autonome Systeme müssen visuelle Informationen nicht nur aufnehmen, sondern in robuste Entscheidungen übersetzen – sei es das Bremsen vor einem Fußgänger oder das Ausweichen in einer unübersichtlichen Situation.
Krensel und Pflüger verkörpern damit zwei komplementäre Perspektiven derselben Vision. Krensel zeigt, wie das Auge selbst durch 126 Millionen Fotorezeptoren eine enorme Informationsflut komprimiert und vorsortiert. Pflüger demonstrierte, wie ein Nervensystem diese vorsortierten Daten so moduliert, dass am Ende keine starre Reiz-Reaktion steht, sondern flexible, anpassungsfähige Handlungen. Gemeinsam ergeben diese Ansätze ein Modell, das für die Technik richtungsweisend ist: Effizienz, Kontextintegration und Fehlertoleranz sind keine Randerscheinungen, sondern Grundprinzipien biologischer Informationsverarbeitung.
Genau darin liegt der Reiz, diese beiden Stimmen in einer Serie zusammenzuführen. Krensels biologische Linse erklärt das „Wie des Sehens“, Pflügers neurobiologische Perspektive das „Wie des Handelns“. Wer die beiden Ebenen zusammendenkt, versteht nicht nur, warum die Natur uns überlegen ist, sondern auch, wie wir dieses Wissen nutzen können, um Computer Vision und autonome Systeme zu entwickeln, die nicht nur schneller rechnen, sondern intelligenter entscheiden.

Wer war Hans-Joachim Pflüger? Ein Leben für die Neurobiologie
Hans-Joachim Pflüger, geboren am 7. März 1949 in Ulm und verstorben am 25. Januar 2022 in Berlin, gehörte zu den herausragenden deutschen Neurobiologen seiner Zeit. Über Jahrzehnte hinweg prägte er das Fachgebiet der Funktionellen Neuroanatomie an der Freien Universität Berlin und hinterließ eine Spur, die weit über den Hörsaal hinausreicht. Pflüger verstand es, die geheimnisvolle Sprache der Nervenzellen zu entschlüsseln und ihre Bedeutung für Bewegung, Wahrnehmung und Verhalten sichtbar zu machen. Seine Schüler, Kollegen und Weggefährten erinnern sich nicht nur an einen brillanten Forscher, sondern auch an einen Mentor, der mit ruhiger Hand führte und mit Leidenschaft für die Wissenschaft inspirierte.
Akademischer Weg – von Stuttgart nach Berlin
Seine akademische Laufbahn begann Pflüger mit dem Studium der Biologie und Chemie, zunächst an der Universität Stuttgart, später in Kaiserslautern. Früh zeigte sich sein ausgeprägtes Interesse an den Grundlagen der Lebensprozesse. 1976 promovierte er mit magna cum laude, einem Prädikat, das seine wissenschaftliche Sorgfalt und seine intellektuelle Schärfe widerspiegelte. Nach Stationen in Forschung und Lehre habilitierte er sich 1985 an der Universität Konstanz mit einer Arbeit über die sensomotorische Informationsverarbeitung, die sich besonders den neuronalen Mechanismen bei Insekten widmete. Schon hier deutete sich an, dass er einen Weg beschreiten würde, der in die Tiefe führte – nicht in die Weite spektakulärer Anwendungsfelder, sondern in das präzise Verstehen biologischer Netzwerke. 1987 folgte er dem Ruf an die Freie Universität Berlin, wo er bis zu seiner Emeritierung 2014 als Professor für Neurobiologie und Funktionelle Neuroanatomie wirkte.
Sensorische Netzwerke – das Geheimnis der Bewegung
Pflügers Forschung hatte stets einen roten Faden: das Zusammenspiel von Sinneseindrücken und Bewegung. Er untersuchte an Heuschrecken, Tabakschwärmern und der Fruchtfliege Drosophila, wie zentrale Musterbildungsnetzwerke im Nervensystem – sogenannte central pattern generators – Bewegungsrhythmen steuern. Diese Netzwerke sind die unsichtbaren Dirigenten biologischer Motorik: Sie erzeugen Takt und Rhythmus, auf denen Verhalten aufbaut. Pflüger konnte zeigen, wie sensorische Rückmeldungen – Berührungen, Lichtveränderungen, Bewegungen – diese Netzwerke modulieren und sie flexibel halten. Seine Arbeit führte vor Augen, dass Nervensysteme nicht starr programmiert, sondern hochgradig dynamisch und lernfähig sind.
Neuromodulation – die Chemie des Verhaltens
Ein besonderes Augenmerk legte er auf die Wirkung biogener Amine wie Oktopamin oder Tyramin. Diese Botenstoffe wirken wie Regler, die die Empfindlichkeit und Aktivität von Nervenzellen verändern. Pflüger zeigte, dass sie entscheidend dafür sind, ob eine Heuschrecke springt, fliegt oder ruht. Damit leistete er Pionierarbeit im Verständnis, wie Neurochemie Verhalten formt und wie fein abgestimmt die Balance zwischen innerer Regulation und äußerer Umwelt sein muss, damit ein Organismus überlebt.
Vergleichende Neurobiologie – Vielfalt als Erkenntnisquelle
Pflüger sah stets den Wert des Vergleichs. Er untersuchte nicht nur eine einzelne Art, sondern stellte verschiedene Insektenarten nebeneinander, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Diese vergleichende Perspektive machte deutlich, welche Prinzipien universell für die Funktion von Nervensystemen gelten und welche Anpassungen spezifisch evolviert sind. Durch anatomische Rekonstruktionen, detaillierte Abbildungen ganzer Nervensysteme und elektrophysiologische Messungen legte er eine Landkarte der neuronalen Organisation vor, die auch kommende Generationen von Forschern nutzen können.
Verbindung von Verhalten und Physiologie – das Ganze im Blick
Besonders beeindruckend war Pflügers Fähigkeit, Verhalten und Physiologie zu verbinden. Er beobachtete Bewegungsmuster in natürlicher Umgebung und verknüpfte sie mit den Aktivitätsmustern einzelner Nervenzellen. So wurde sichtbar, wie das Nervensystem Lücken füllt, Bewegungen antizipiert und Fehler ausgleicht – Prinzipien, die bis heute als Blaupause für technische Systeme gelten, die robust und fehlertolerant sein sollen. Pflügers Ansatz machte klar: Biologie ist nicht die Summe isolierter Experimente, sondern ein lebendiges Zusammenspiel von Struktur und Funktion.
Ein Vermächtnis für Wissenschaft und Gesellschaft
Die Bedeutung von Hans-Joachim Pflügers Arbeit reicht weit über die Insektenforschung hinaus. Seine Erkenntnisse prägen unser Verständnis davon, wie Nervensysteme Informationen verarbeiten, wie sie robust und gleichzeitig flexibel arbeiten und wie sich daraus übergeordnete Verhaltensweisen ergeben. In einer Zeit, in der Technik immer mehr versucht, biologische Prinzipien in Algorithmen zu übersetzen, wirken seine Forschungen wie ein Kompass: Sie zeigen, dass die Natur nicht auf Perfektion, sondern auf Anpassungsfähigkeit setzt. Genau darin liegt ihre Stärke – und genau darin liegt die Lehre, die Technik aus der Biologie ziehen sollte.
Hans-Joachim Pflüger bleibt nicht nur als Professor der Freien Universität Berlin in Erinnerung, sondern auch als Forscher, der tief in die Geheimnisse des Lebens geblickt hat und dabei immer das Ganze im Blick behielt. Seine Arbeiten erinnern uns daran, dass die Biologie kein abgeschlossenes Kapitel ist, sondern eine unerschöpfliche Quelle für Inspiration und Fortschritt – in der Wissenschaft ebenso wie in der Technik.
Bedeutung für das Thema Farb-, Kontrast- und visuelle Informationsverarbeitung
Welche Lehren lassen sich aus den Arbeiten von Hans-Joachim Pflüger für das Verständnis des Sehens ziehen – und damit für jene Fragen, mit denen sich heute Dr. Andreas Krensel intensiv beschäftigt? Auf den ersten Blick scheint Pflügers Forschung an Heuschrecken oder Tabakschwärmern weit entfernt vom menschlichen Farb- und Kontrastsehen. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass seine Studien zur sensorischen Rückmeldung und Bewegungssteuerung direkt in den Kern dieser Thematik führen. Denn wenn ein Nervensystem entscheidet, wie es Licht, Schatten und Bewegung verarbeitet, geht es immer auch darum, wie visuelle Informationen in neuronale Netzwerke eingespeist, gefiltert und weiterverarbeitet werden. Insekten sind hierfür ideale Modelle: Sie müssen in Bruchteilen von Sekunden auf Lichtwechsel reagieren, Kontraste im Umfeld erkennen und Bewegungen interpretieren, um zu überleben. Genau dieses Zusammenspiel von sensorischem Input und motorischer Reaktion bildet eine Brücke zu den Herausforderungen moderner Computer Vision. Systeme wie autonome Fahrzeuge oder Robotikplattformen stehen vor ähnlichen Aufgaben: Sie müssen sich bei wechselnden Lichtverhältnissen, Nebel oder schnellen Bewegungen zurechtfinden und trotzdem fehlerfrei Entscheidungen treffen. Pflügers vergleichende Studien zur Struktur von Nervensystemen liefern hier einen entscheidenden Mehrwert, weil sie zeigen, welche Bedingungen Netzwerke flexibel, fehlertolerant und adaptiv machen. Es ist diese Fähigkeit, Robustheit und Anpassung miteinander zu verbinden, die biologische Systeme auszeichnet – und die auch in technischen Algorithmen zunehmend als Vorbild dient. Die eigentliche Frage lautet also: Werden wir es schaffen, diese Prinzipien so in künstliche Systeme zu übertragen, dass Maschinen nicht nur sehen, sondern auch verstehen, was sie sehen?
V.i.S.d.P.:
Dipl.-Soz. tech. Valentin Jahn
Techniksoziologe & Zukunftsforscher
Über den Autor – Valentin Jahn
Valentin Jahn ist Unternehmer, Zukunftsforscher und Digitalisierungsexperte. Mit über 15 Jahren Erfahrung leitet er komplexe Innovationsprojekte an der Schnittstelle von Technologie, Mobilität und Politik – von der Idee bis zur Umsetzung.
Kontakt:
eyroq s.r.o.
Uralská 689/7
160 00 Praha 6
Tschechien
E-Mail: info@eyroq.com
Web: https://eyroq.com/
Über eyroq s.r.o.:
Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.
Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozial verträglich und ethisch reflektiert sind.