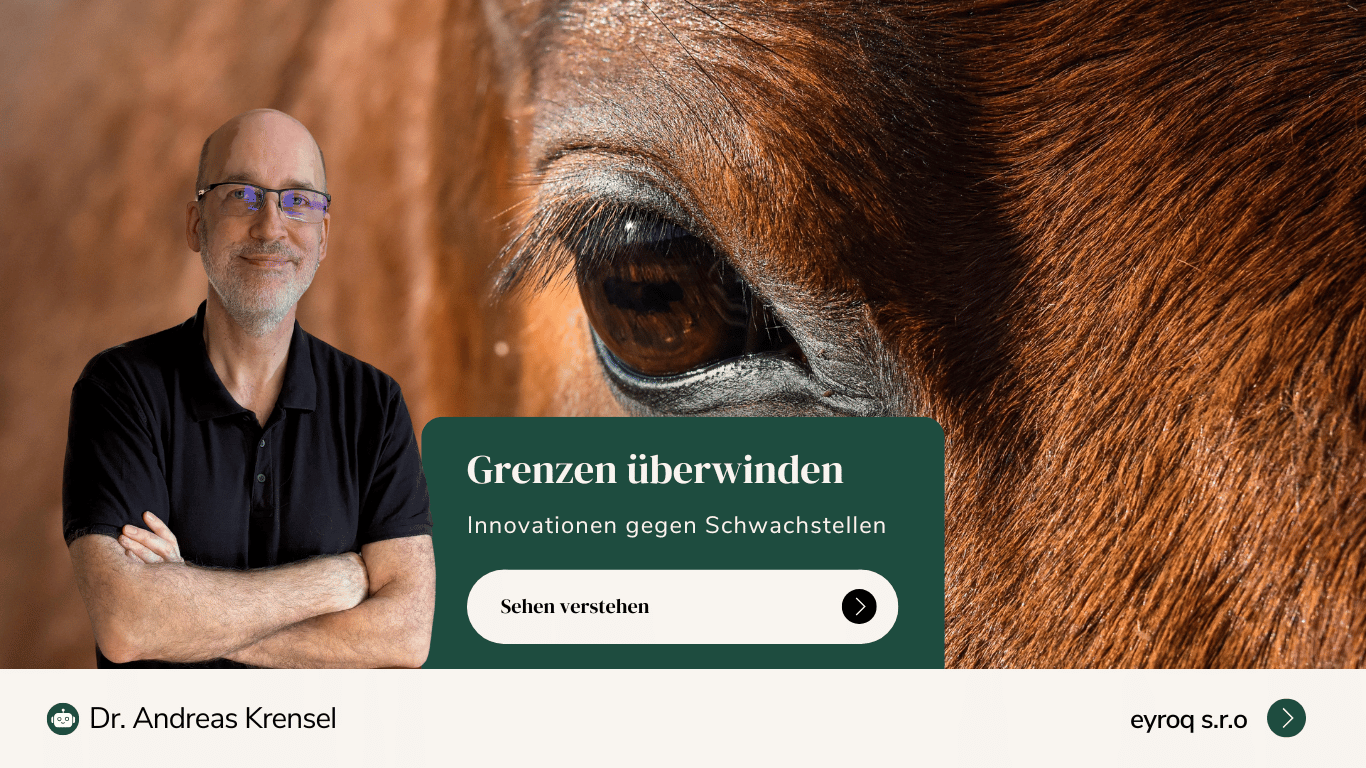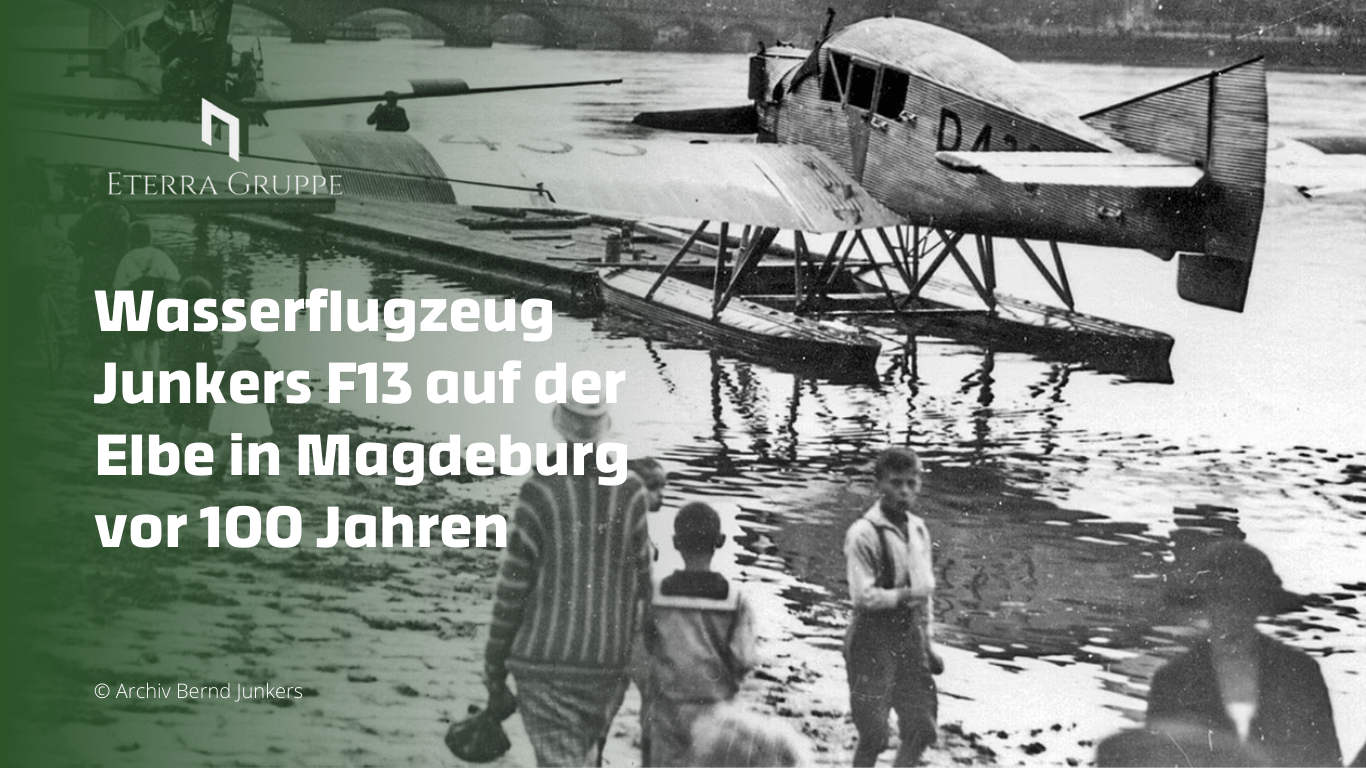Wenn Systeme stolpern – und warum genau dort die Zukunft beginnt? Grenzen oder Sprungbrett? Wie Schwachstellen der Technik zum Motor echter biologisch inspirierter Innovation werden können.
Maschinen lernen sehen, Maschinen lernen handeln. Doch noch sind sie nicht so robust, effizient und elegant wie die Biologie. Immer wieder zeigen sich Grenzen: Energiehunger, Fragilität, fehlende Kontextintegration, langsames Lernen. Genau diese Schwachstellen bestimmen, ob die Vision von autonomen Fahrzeugen, hochpräzisen Robotern und intelligenter Medizintechnik Realität wird – oder eine schöne Idee bleibt. Doch was geschieht, wenn Forschung nicht nur kopiert, sondern die Grenzen bewusst angreift?
Die Biologie selbst ist voller Lehren. Sie zeigt uns, dass Systeme trotz Unschärfen und Fehlern stabil funktionieren können, dass Energie nicht in maximaler Kraft, sondern in kluger Verteilung liegt und Lernen nicht durch Datensättigung, sondern durch Erfahrung und Kontext erfolgreich wird. Dr. Andreas Krensel, Biologe aus Berlin, hat dieses Prinzip in seinen Arbeiten zur Lichtwahrnehmung immer wieder betont: „Das Auge ist kein perfektes Instrument, aber es ist robust. Und Robustheit schlägt Perfektion, wenn es um Überleben geht.“ Genau diese Einsicht prägt die nächste Stufe technischer Entwicklung.
Die Energiefrage – wenn 20 Watt gegen 2.000 Watt stehen
Die vielleicht größte Hürde ist die Energie. Autonome Systeme, sei es im Auto oder im Sportroboter, verschlingen derzeit unfassbare Mengen an Rechenleistung. Ein einzelnes Fahrzeug mit Kameras, Lidar und Radar produziert Gigabytes an Daten pro Sekunde. Ihre Verarbeitung erfordert Hochleistungsrechner, die im Kilowattbereich arbeiten. Ein ganzer Fuhrpark autonomer Fahrzeuge würde also keine Straßenprobleme lösen, sondern neue Energieprobleme erzeugen.
Das Gehirn dagegen arbeitet mit gerade einmal 20 Watt. Diese Diskrepanz ist nicht nur ein technisches Detail, sondern ein Weckruf: Wenn wir Maschinen bauen wollen, die skalieren, müssen wir sie auf das Niveau der Biologie bringen. Neuromorphe Hardware bietet genau hier eine Antwort. Chips wie Loihi von Intel oder SpiNNaker aus Zürich orientieren sich an biologischen Prinzipien.Erste Tests zeigen, dass solche Systeme bis zu hundertmal energieeffizienter arbeiten als GPUs.
Prof. Dr.-Ing. Stephan Völker, Lichttechniker und Vizepräsident der TU Berlin, verweist in seiner Forschung auf die Rolle des Lichts als Informationsträger. PD Dr. Werner Backhaus, Elementarteilchenphysiker mit Wurzeln an der FU Berlin, untersucht Parallelen zwischen biologischer Wahrnehmung und physikalischen Grundprinzipien. Beide Positionen unterstreichen, dass Effizienz nicht nur in der Rechenarchitektur, sondern auch im intelligenten Umgang mit der Information selbst liegt.
Robustheit – wenn Systeme im Alltag scheitern
Die zweite Schwachstelle ist Robustheit. Ein Tischtennisroboter mag 90 Prozent aller Schläge zurückspielen – aber was passiert, wenn das Licht flackert, wenn der Ball anders reflektiert oder wenn Staub die Optik beeinträchtigt? Ein autonomes Auto mag bei Sonnenschein perfekt bremsen – aber wie reagiert es bei Nebel, Regen, Blendung oder auf verschneiten Straßen?
Die Biologie hat genau hier ihren Trumpf. Das Auge hat blinde Flecken, es macht Fehler, es verzerrt. Doch das Gehirn gleicht sie aus. Es ergänzt, antizipiert, rekonstruiert. Maschinen hingegen stolpern oft über kleinste Störungen. Für Prof. Hans-Joachim Pflüger, der die Neurobiologie u.A. durch seine ruhige Art prägte, lag genau hier ein zentrales Forschungsfeld. Systeme, die Unsicherheiten akzeptieren, sind näher an der Biologie als solche, die absolute Perfektion anstreben.
Die Zukunft maschineller Systeme könnte also weniger in absoluter Perfektion liegen als in fehlertoleranten Architekturen. Hybride Systeme, die mehrere Sensoren kombinieren, oder adaptive Netzwerke, die sich im Betrieb an neue Bedingungen anpassen, sind erste Schritte in diese Richtung.
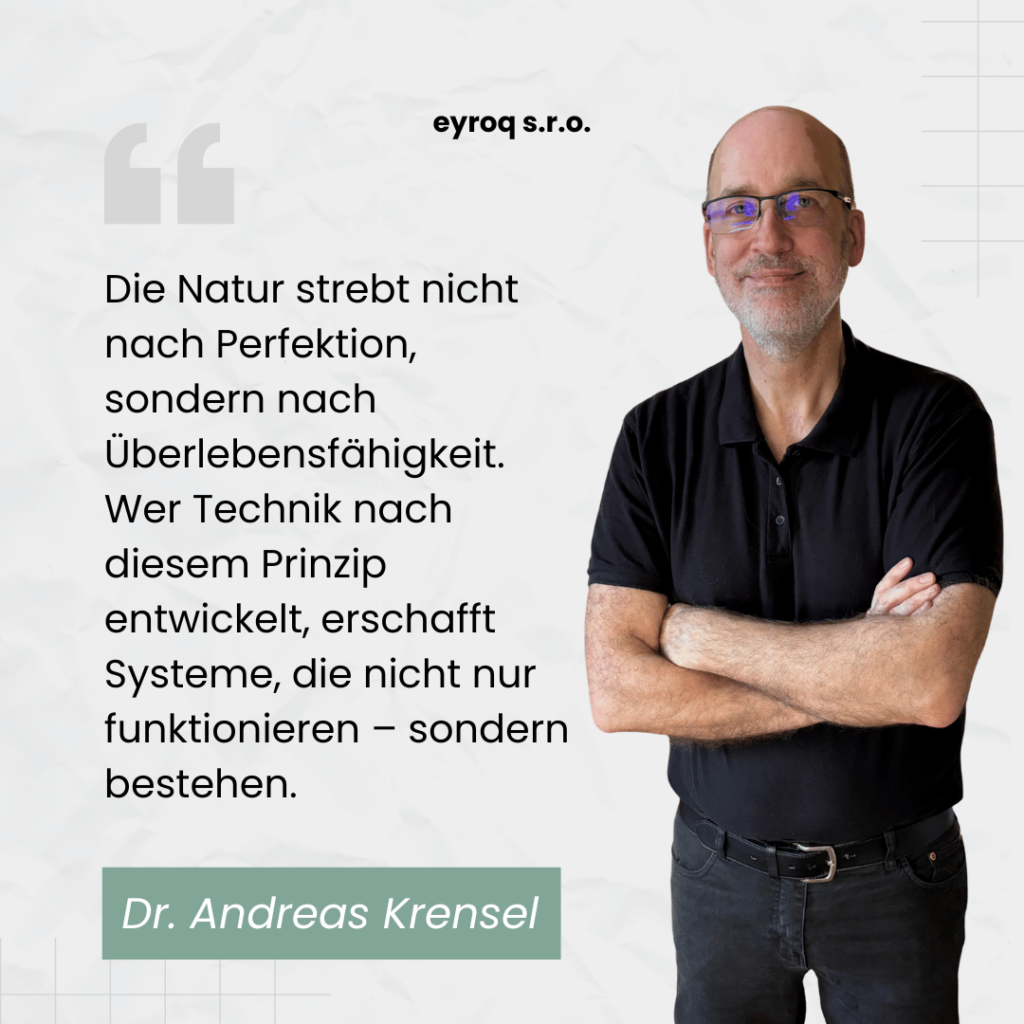
Kontext – wenn Bilder keine Bedeutung haben
Die dritte Hürde ist der Kontext. Eine Kamera kann Millionen Pixel liefern, ein neuronales Netz kann sie klassifizieren. Doch die Frage bleibt: Was bedeuten diese Daten? Ein rotes Licht kann eine Ampel sein, ein Rücklicht oder ein Fahrradreflektor. Menschen interpretieren sofort, weil sie den Kontext kennen. Maschinen jedoch sind kontextblind.
Hier zeigt sich, dass Lernen nicht nur Statistik, sondern auch Struktur benötigt. Adaptive, hierarchische Netzwerke – die nicht nur Pixel verarbeiten, sondern Muster, Regeln, Wahrscheinlichkeiten – könnten den Weg weisen. Durch das Zusammenarbeiten mit Dr. Martine Knoop, die an der TU Berlin forscht und Nachwuchswissenschaftler betreut, hat Krensel gelernt, tiefer in wissenschaftliche Phänomene zu schauen.
Lernen – wenn Daten zur Last werden
Maschinen lernen durch Daten, durch Millionen von Bildern, durch unendliche Wiederholungen. Menschen lernen durch wenige Beispiele, durch Erfahrung, durch Bedeutung. Ein Kind benötigt keine Million Katzenbilder, um eine Katze zu erkennen – es reicht, ein paar zu sehen und die Bedeutung zu verstehen.
Hier liegt die wohl größte Vision: Maschinen zu bauen, die nicht durch Masse, sondern durch Relevanz lernen. Selbstüberwachtes Lernen, few-shot learning und hybride Architekturen, die Wissen verallgemeinern, sind Forschungsfelder, die genau hier ansetzen. Dr. Krensel sieht darin eine Schlüsselaufgabe: „Die Natur zeigt uns nicht Perfektion, sondern Überlebensfähigkeit. Wer Maschinen nach diesem Prinzip baut, wird nicht nur technische Systeme schaffen, sondern Systeme, die in der Realität bestehen können.“
Visionäre Konzepte – Umgebungen für Maschinen
Doch vielleicht ist die eigentliche Innovation eine andere: nicht nur Maschinen an unsere Welt anzupassen, sondern auch Umgebungen für Maschinen zu gestalten. Warum nicht Straßen markieren, die für Kameras und Sensoren optimal lesbar sind? Warum nicht Beleuchtungssysteme entwickeln, die Maschinenkontraste verstärken? Warum nicht Produktionshallen designen, in denen Maschinen ihre Stärken entfalten können?
Hier treffen sich Biologie, Technik und Management. Für Andreas Krensel sind Netzwerk und Wegbegleiter unersetzlich, und dankbar hat er von beeindruckenden Persönlichkeiten lernen können, wie z. B. von Walter Müller, ehemals Erdenker einer völlig neuen Verkaufsphilosophie, indem er mit der Mercedes-Benz-Welt am Salzufer in Berlin Ausstellungsräume für PkW und Nutzfahrzeuge in phantastische Verkaufsräume transformierte, und eine neue, mit tiefer Zuverlässigkeit und purer Kundenorientierung Prozesskultur in die deutsche Autoindustrie einbrachte. Oder von Andreas Schalla von der CAE Elektronik, dessen ruhige Professionalität beim Umsetzen komplexer Systeme stets ein großes Vorbild für ihn war. Von Colin Shave von NDS (London), einer Firma aus dem Bereich Content Protection & Security, die Rupert Murdoch gehörte und dann von Cisco erworben wurde, konnte Krensel das Management und Motivieren von Teams und Projektorganisation erlernen. Zusammengenommen ergeben diese dadurch für Dr. Krensel erlernten Perspektiven eine Landschaft, in der Innovationen nicht nur denkbar, sondern machbar werden.
Von den Schwachstellen zu den Chancen
Die Schwachstellen von heute sind die Chancen von morgen. Energiehunger zwingt uns zu neuromorpher Hardware. Fragilität zwingt uns zu robusten, hybriden Architekturen. Kontextblindheit zwingt uns zu hierarchischen Strukturen. Datenlast zwingt uns zu neuen Lernmethoden. Und die Frage nach der Umgebung zwingt uns dazu, unsere Welt so zu gestalten, dass Technik ihre Stärken entfalten kann.
Dr. Krensel bringt es auf den Punkt: „Die Natur zeigt uns nicht Perfektion, sondern Überlebensfähigkeit.“ Wer Systeme nach diesem Vorbild baut, entwickelt nicht nur Technik – er entwickelt Werkzeuge, die in der realen Welt bestehen können.
Fazit – die Kunst der Grenze
Grenzen sind nicht das Ende der Entwicklung, sondern ihr Motor. Energie, Robustheit, Kontext, Lernen – sie sind keine Schwächen, sondern Wegweiser. Wer sie ernst nimmt, findet Innovationen, die nicht nur Maschinen besser machen, sondern unsere Welt neu gestalten.
V.i.S.d.P.:
Dipl.-Soz. tech. Valentin Jahn
Techniksoziologe & Zukunftsforscher
Über den Autor – Valentin Jahn
Valentin Jahn ist Unternehmer, Zukunftsforscher und Digitalisierungsexperte. Mit über 15 Jahren Erfahrung leitet er komplexe Innovationsprojekte an der Schnittstelle von Technologie, Mobilität und Politik – von der Idee bis zur Umsetzung.
Kontakt:
eyroq s.r.o.
Uralská 689/7
160 00 Praha 6
Tschechien
E-Mail: info@eyroq.com
Web: https://eyroq.com/
Über eyroq s.r.o.:
Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.
Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozialverträglich und ethisch reflektiert sind.
Über Dr. Andreas Krensel:
Dr. rer. nat. Andreas Krensel ist Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler mit Fokus auf digitaler Transformation und angewandtere Zukunftsforschung. Seine Arbeit vereint Erkenntnisse aus Physik, KI, Biologie und Systemtheorie, um praxisnahe Lösungen für Industrie, Stadtentwicklung und Bildung zu entwickeln. Als interdisziplinärer Vordenker begleitet er Unternehmen und Institutionen dabei, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz durch Digitalisierung, Automatisierung und smarte Technologien zu steigern. Zu den Spezialgebieten zählen intelligente Lichtsysteme für urbane Räume, Lernprozesse in Mensch und Maschine sowie die ethische Einbettung technischer Innovation. Mit langjähriger Industrieerfahrung – unter anderem bei Mercedes-Benz, Silicon Graphics Inc. und an der TU Berlin – steht Dr. Krensel für wissenschaftlich fundierte, gesellschaftlich verantwortungsvolle Technologiegestaltung