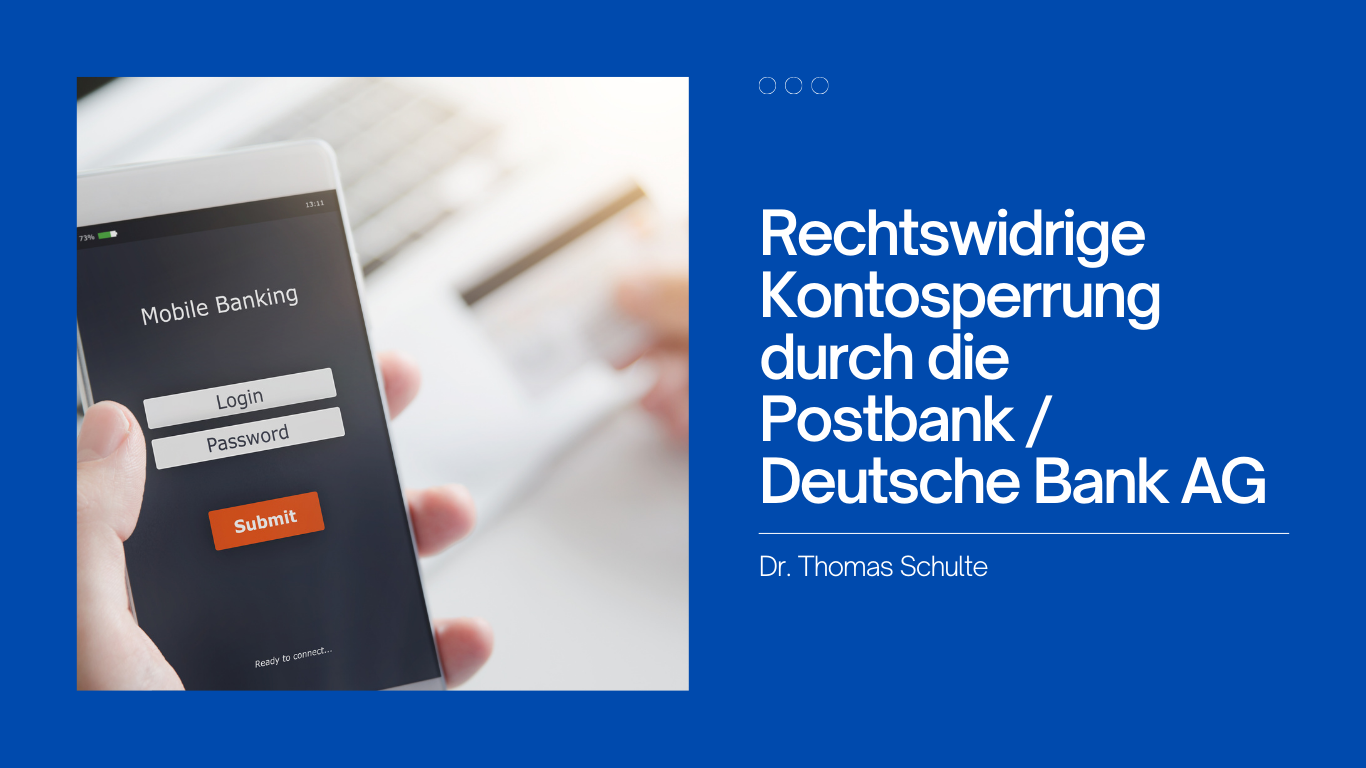Zwischen Regulierung und Realität – wohin steuert Europas Finanzordnung? Wie BaFin, Gesetzgeber und Marktteilnehmer um Stabilität, Vertrauen und wirtschaftliche Zukunft ringen – und warum jetzt beides gefragt ist: juristische Klarheit und wirtschaftlicher Sachverstand.
Die Welt des Finanzrechts befindet sich in einer Phase tiefgreifender Transformation. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationale Sicherheitsrisiken verändern die Spielregeln des globalen Finanzsystems in atemberaubendem Tempo. Allein im Jahr 2024 verzeichnete die BaFin laut ihres Jahresberichtes über 9.800 Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche, ein Anstieg um rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig wächst der Druck, neue Finanztechnologien – von Kryptoassets über Tokenisierung bis hin zu KI-basierten Handelsplattformen – unter rechtliche Aufsicht zu bringen, ohne Innovationen zu ersticken.
Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt aus Berlin mit Schwerpunkt im Bank-, Kapitalmarkt- und Aufsichtsrecht, sieht in dieser Dynamik eine juristische und gesellschaftliche Bewährungsprobe: „Wir erleben derzeit einen Wettlauf zwischen Regulierung und technologischem Wandel. Das Finanzrecht wird zum Schlüsselinstrument, um Ordnung im digitalen Kapitalverkehr zu wahren – aber auch, um Vertrauen in ein System zurückzubringen, das immer schwerer zu durchschauen ist.“
Doch juristische Regelungen allein schaffen noch keine Stabilität. Dr. Peter Riedi, renommierter Finanzexperte aus dem Fürstentum Liechtenstein, ergänzt die wirtschaftliche Perspektive:
„Regulierung darf nicht zum Selbstzweck werden. Sie muss den Markt befähigen, langfristig Werte zu sichern – gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen. Edelmetalle, Rohstoffe und Sachwerte gewinnen wieder an Bedeutung, weil sie das Vertrauen bieten, das Papiergeldmärkte oft verloren haben.“
Dabei rücken auch die sogenannten „Seltenen Erden“ zunehmend in den Fokus. Diese kritischen Rohstoffe sind für Zukunftstechnologien wie Elektromobilität, Windkraft oder Mikroelektronik unverzichtbar. Ihre Verfügbarkeit und strategische Sicherung werden zu einem entscheidenden Faktor wirtschaftlicher Stabilität. „Wer über Rohstoffe verfügt, sichert nicht nur seine industrielle Basis, sondern auch seine finanzielle Souveränität“, betont Dr. Riedi. Für Anleger gewinnen diese Materialien an Bedeutung, da sie langfristig eine Brücke zwischen Nachhaltigkeit, technologischer Unabhängigkeit und realer Wertschöpfung schlagen.
Riedi sieht die derzeitige Neuausrichtung der Aufsichtslandschaft als Teil einer größeren Bewegung: weg von rein formaler Kontrolle hin zu substanzorientierten, risikobasierten Modellen, die nachhaltige Kapitalströme fördern und realwirtschaftliche Stabilität gewährleisten.
Im Zusammenspiel zwischen juristischer Ordnung und ökonomischer Realität entsteht so ein neues Spannungsfeld: Wie viel Regulierung braucht ein stabiler Finanzmarkt – und wie viel Freiheit darf man ihm lassen, um Wachstum und Innovation nicht zu ersticken?
Diese Fragen bilden den Kern der aktuellen Debatte über die Rolle der BaFin als nationale Leitinstanz. Ihre jüngsten Maßnahmen, Konferenzen und Reforminitiativen zeigen, dass Deutschland und Europa vor einem Wendepunkt stehen – zwischen juristischer Verantwortung, wirtschaftlicher Vernunft und dem globalen Anspruch, Vertrauen in ein sich wandelndes Finanzsystem zu bewahren.
Die ESG-Offenlegungspflichten und das Mandat der EBA – Zwischen Ideal und ökonomischer Realität
Ein zentrales Thema in der aktuellen Regulierungspraxis ist die Umsetzung von ESG-Offenlegungspflichten. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat hierzu in den letzten Monaten mehrere Initiativen gestartet, die insbesondere auf mehr Transparenz und Verantwortlichkeit im Finanzsektor zielen. Die Zustimmung der BaFin zum sogenannten „No-Action-Letter“ der EBA vom Oktober 2025 verdeutlicht die gemeinsame Linie europäischer Aufsichtsbehörden, rechtliche Hürden bei der Einführung verbindlicher ESG-Standards zunächst zu reduzieren, um Übergangsfristen sinnvoll ausschöpfen zu können.
„Die ESG-Regulierung ist kein Selbstzweck. Sie setzt wirtschaftliches Handeln in einen ethischen Rahmen, der langfristige Stabilität sichert“, erläutert Dr. Thomas Schulte. Dieser rechtliche Rahmen verpflichtet etwa Banken, Fonds und Versicherer dazu, Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Investitionsentscheidungen transparent offenzulegen. Grundlage hierfür ist die EU-Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088), die klare Maßgaben zu den Informationen enthält, die Finanzmarktteilnehmer veröffentlichen müssen.
Der sogenannte „No-Action-Letter“, den nun auch die BaFin mitträgt, bedeutet in der Praxis das Aussetzen von Sanktionen bei der Nichtumsetzung einzelner technischer Standards – dennoch bleibt die Verpflichtung zur Offenlegung bestehen. Das stellt viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere im Umgang mit uneinheitlichen Datenstandards, globalen Lieferketten und unterschiedlichen nationalen Nachhaltigkeitsdefinitionen.
Hier setzt die Perspektive von Dr. Peter Riedi, Finanzexperte aus Liechtenstein, an. Er mahnt zur ökonomischen Bodenhaftung in der Debatte: „ESG darf nicht zum bürokratischen Bremsklotz werden. Wer Nachhaltigkeit will, muss sie auch wirtschaftlich denken. Viele mittelständische Unternehmen kämpfen nicht mit fehlendem Willen, sondern mit fehlender Datenbasis, unklaren Bewertungsmaßstäben und steigenden Kosten. Das Risiko besteht, dass Regulierung Kapital aus Europa abzieht, statt es für echte Transformation zu mobilisieren.“
Riedi verweist auf einen zentralen Widerspruch: Während große internationale Finanzhäuser in der Lage sind, ESG-Kriterien mit digitalen Tools und spezialisierten Abteilungen umzusetzen, geraten kleinere Marktteilnehmer zunehmend unter Druck. Die Kosten der Compliance, so Riedi, könnten sich künftig zu einem systemischen Wettbewerbsnachteil entwickeln – gerade für jene Unternehmen, die tatsächlich nachhaltig wirtschaften, aber die administrativen Lasten kaum noch tragen können.
Beide Experten, Schulte und Riedi, eint die Erkenntnis: Die ESG-Regulierung ist notwendig und richtig, doch sie muss mit der ökonomischen Realität Schritt halten. Zwischen juristischem Idealismus und betriebswirtschaftlicher Umsetzbarkeit liegt der Weg, auf dem Europas Finanzsystem seine Glaubwürdigkeit und Stabilität bewahren kann.

Live-Auftritte der BaFin auf dem Börsentag: Kommunikation als Aufsichtspflicht
Im Oktober 2025 war die BaFin auf dem Börsentag in Berlin sowie in Hamburg vertreten. Diese Veranstaltungen erlauben es privaten und institutionellen Anlegern, in direkten Kontakt mit der Behörde zu treten sowie aktuelle Fragestellungen rund um Markttransparenz und Anlegerinformation zu diskutieren. Dr. Thomas Schulte begrüßt diese Sichtbarkeit der Aufsichtsbehörde ausdrücklich: „Ein effektives Finanzaufsichtssystem lebt von Transparenz, Dialog und Zugänglichkeit. Die BaFin erfüllt hier nicht nur eine Kontroll-, sondern auch eine Bildungsfunktion.“ Die Möglichkeit, regulatorische Entwicklungen aus erster Hand zu erfahren, stellt für viele Marktteilnehmer einen immensen Vorteil dar und ist ein Schritt in die richtige Richtung zur Förderung von Compliance und regelkonformem Verhalten aller Teilnehmer.
Zukunft der Versicherungsaufsicht: Konferenz in Bonn 2025 – zwischen Regulierungsdruck und wirtschaftlicher Erneuerung
Auch die Versicherungsbranche steht vor immensen Transformationen: Digitalisierung, demografischer Wandel, neue Kundenbedürfnisse und die Notwendigkeit nachhaltiger Investitionen zwingen Versicherer, ihre Geschäftspraktiken tiefgreifend zu reformieren. Im Mittelpunkt der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht am 29. Oktober 2025 in Bonn stand daher die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Branche – juristisch, ökonomisch und gesellschaftlich.
„Versicherungsaufsicht bedeutet heutzutage mehr als nur Risikobewertung. Es geht zunehmend um die systemische Stabilität und das Vertrauen der Bevölkerung“, erklärt Dr. Thomas Schulte. In rechtlicher Hinsicht bedeutet dies die kontinuierliche Anpassung des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) sowie eine enge Verflechtung mit europäischen Vorgaben wie Solvency II. Auch Kunden- und Datenschutzaspekte gewinnen an Bedeutung und verlangen eine präzise rechtliche Navigation durch ein immer dichteres Regelgeflecht.
Neue Technologien wie Blockchain, künstliche Intelligenz und Smart Contracts eröffnen neue Horizonte in der Risikoabschätzung und Produktentwicklung. Doch sie bringen zugleich neue Grauzonen hervor: Wer haftet, wenn eine KI-gestützte Risikobewertung fehlerhaft ist? Wie lässt sich algorithmische Transparenz mit Datenschutz und Wettbewerbsrecht vereinbaren? „Die Rechtsordnung hinkt technologischen Entwicklungen oft hinterher – die Versicherungswirtschaft darf sich jedoch nicht auf Experimentierklauseln berufen, wenn es um den Schutz von Verbraucherinteressen geht“, mahnt Dr. Schulte.
An dieser Stelle ergänzt Dr. Peter Riedi mit Blick aus Liechtenstein und wirtschaftlicher Schärfe: „Wir erleben einen historischen Wendepunkt. Versicherungen müssen vom reaktiven Risikomanager zum proaktiven Vermögensarchitekten werden. Das Kapital, das in Versicherungsfonds gebunden ist, ist enorm, allein in Deutschland über 1,7 Billionen Euro. Die Frage ist nicht mehr, ob dieses Kapital nachhaltiger investiert werden sollte, sondern wie es ökonomisch sinnvoll und langfristig werthaltig eingesetzt werden kann.“
Riedi betont, dass Versicherer künftig stärker als institutionelle Investoren mit gesellschaftlichem Auftrag agieren müssen: Sie sollen Stabilität sichern, aber auch Innovation ermöglichen. Etwa durch Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltige Infrastruktur oder Edelmetallportfolios als Stabilitätsanker in volatilen Märkten. „Versicherungsgelder sind keine toten Gelder. Sie müssen arbeiten, aber sie dürfen nicht spekulieren. Hier liegt die ökonomische Balance zwischen Verantwortung und Rendite“, so Riedi.
In diesem Kontext spielen auch strategische Rohstoffe wie Seltene Erden eine zunehmend wichtige Rolle. Sie sind das Rückgrat moderner Technologien und zugleich ein begrenztes Gut, dessen Wert durch geopolitische Spannungen weiter steigt. „Versicherer und institutionelle Investoren sollten diese Entwicklung nicht unterschätzen. Wer heute in die Materialbasis der Zukunft investiert, stärkt die Realwirtschaft und schafft echte Substanzwerte“, so Riedi
Gemeinsam zeigen Schulte und Riedi zwei Perspektiven auf denselben Prüfstein: Während der Jurist auf die rechtliche Konsistenz und Verbrauchersicherheit pocht, fordert der Ökonom die Rückkehr zu Substanzwerten und nachhaltiger Kapitalpolitik. Die Zukunft der Versicherungsaufsicht, dies wurde in Bonn deutlich, liegt nicht nur in Paragrafen oder Algorithmen, sondern im Mut, beides zu verbinden: rechtliche Präzision mit wirtschaftlicher Vernunft.
Wirtschaftskriminalität im Fokus: Hawala-Banking und Betrugsplattformen
Das „21. Praxisforum Wirtschaftskriminalität“ im November 2025 stellte besonders sensible Themen in den Vordergrund. Hierzu gehörte unter anderem das sogenannte „Hawala-Banking“ – ein informelles Überweisungssystem, das außerhalb regulierter Banken operiert. Juristisch betrachtet handelt es sich häufig um Verstöße gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) sowie die Geldwäschevorgaben nach dem Geldwäschegesetz (GwG).
Die Bundesbehörden arbeiten zunehmend grenzüberschreitend an der Überwachung und Bekämpfung solcher informeller Geldkreisläufe. Besonders hervorzuheben ist laut Dr. Schulte die Schwierigkeit der Beweissicherung: „In vielen Fällen operieren Hawala-Systeme vollkommen dokumentenlos. Die rechtliche Bewertung verlagert sich hier weg vom Nachweis einzelner Transaktionen hin zur Einordnung von Gesamtstrukturen als potentiell kriminell.“
Parallel hierzu rücken digitale Betrugsplattformen in den Fokus, oftmals mit Messengerdiensten wie WhatsApp oder Telegram als Kommunikationsmittel. Hier stellt sich für Juristen immer häufiger die Frage nach der Zurechenbarkeit von Aussagen in anonymisierten Chats sowie der rechtlichen Tragweite von Emoticons, Kurzbefehlen und Chatverläufen in der Vertragsanbahnung – ein zunehmend wichtiges Aufgabenfeld auch im Bereich des Beweisrechts.

Ein europäischer Meilenstein im Kampf gegen Finanzkriminalität – die AMLA als neues Machtzentrum der Aufsicht
Ein besonders gewichtiger Meilenstein stellt das EU-AML-Paket dar, das unter anderem die Gründung der neuen europäischen Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) vorsieht. Ihre operative Einführung wird weitreichende Konsequenzen für alle Akteure im Finanzsektor haben – von Banken über Kryptodienstleister bis hin zu Versicherern. Ziel ist eine harmonisierte, grenzüberschreitende Aufsicht, die nicht nur nationale Unterschiede glättet, sondern auch Lücken in der bisherigen Geldwäschebekämpfung schließt.
Am 20. November 2025 diskutiert die BaFin im Rahmen der 7. Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die zentralen Herausforderungen und Maßnahmen, die sich aus diesem Reformpaket ergeben. Aus juristischer Perspektive bleibt offen, wie die AMLA künftig mit nationalen Behörden kooperieren wird – denkbar sind sowohl Weisungsbefugnisse als auch koordinierende Kontrollmechanismen. Für die Praxis bedeutet dies eine weitere Verdichtung der Compliance-Pflichten und eine mögliche Neustrukturierung interner Kontrollsysteme.
Gerade digital operierende Finanzunternehmen geraten zunehmend in den Fokus der Aufsicht, da kryptobasierte Zahlungen, NFTs und digitale Vermögenswerte ein besonders hohes Missbrauchspotenzial bieten. Hier müssen die §§ 1 Abs. 24 und 25 Geldwäschegesetz (GwG), die Kryptowertedienstleister ausdrücklich unter Aufsicht stellen, künftig mit noch größerer Konsequenz angewandt werden.
Dr. Peter Riedi bewertet die neuen Maßnahmen aus ökonomischer Sicht ambivalent – als Chance und Herausforderung zugleich: „Die Gründung der AMLA ist ein logischer und notwendiger Schritt, um Europa finanziell resilienter zu machen. Doch sie bringt auch neue Spannungsfelder mit sich: Zwischen Effizienz und Bürokratie, zwischen Kontrolle und Wettbewerbsfähigkeit. Die Compliance-Kosten steigen erheblich – insbesondere für mittelständische Finanzdienstleister und FinTechs, die nicht über dieselben Ressourcen verfügen wie Großbanken.“
Riedi betont, dass die neue Aufsichtsstruktur zwar Transparenz fördert, aber auch Kapitalströme verlangsamen könnte: „Jede neue Kontrollinstanz ist auch ein Nadelöhr für Liquidität. Wenn Prüfprozesse länger dauern und Transaktionen verstärkt überwacht werden, kann dies den europäischen Kapitalmarkt im globalen Wettbewerb bremsen. Andererseits schafft die AMLA ein Umfeld, in dem seriöse Anbieter gestärkt und unseriöse schneller erkannt werden – und das ist langfristig ein Stabilitätsvorteil.“
In seiner Analyse weist Riedi darauf hin, dass der Erfolg der AMLA davon abhängen wird, wie gut juristische Präzision und ökonomische Pragmatik zusammenspielen. Nur wenn regulatorische Vorgaben marktorientiert umgesetzt werden, kann Europa eine Aufsichtskultur entwickeln, die Geldwäsche verhindert, aber Innovation zulässt.
Für die Zukunft sieht er einen klaren Auftrag: „Europa braucht eine Aufsicht mit wirtschaftlichem Verständnis. Nur wer die Kapitalflüsse begreift, kann sie wirksam schützen.“
Damit formuliert Riedi die Kernfrage, die Politik, Wirtschaft und Aufsicht gleichermaßen betrifft: Wie gelingt es, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu bringen – ohne die Dynamik der Finanzmärkte zu ersticken?
DORA und die IT-Aufsicht im Finanzsektor: Wenn digitale Stabilität zur Führungsfrage wird?
Am 4. Dezember 2025 veranstaltet die BaFin eine digitale Informationsveranstaltung zum Thema DORA, dem Digital Operational Resilience Act. Dieser europäische Rechtsrahmen schafft erstmals ein integriertes System aus technischen, organisatorischen und rechtlichen Pflichten, um die digitale Widerstandsfähigkeit von Finanzunternehmen zu sichern. In einer Zeit, in der Cyberangriffe, Systemausfälle und Datenverluste zu realen Bedrohungen für die Finanzstabilität geworden sind, markiert DORA einen Paradigmenwechsel: digitale Resilienz wird zur gesetzlichen Pflicht.
„DORA verlangt nicht nur technische Maßnahmen, sondern auch klare Verantwortlichkeiten innerhalb der Unternehmensführung“, betont Dr. Thomas Schulte. Hier greifen § 25a KWG, die MaRisk und § 91 Abs. 2 AktG ineinander – sie verlangen eine ordnungsgemäße, vorausschauende Unternehmensorganisation. IT-Sicherheitsvorfälle sind damit nicht länger reine Technikpannen, sondern können rechtlich als Organisations- oder Führungsversagen bewertet werden, mit potenziell erheblichen Haftungsfolgen für das Management.
Aus Sicht der Unternehmen bedeutet dies die Einführung neuer Haftungsdimensionen bei Fehlkonfigurationen, IT-Ausfällen oder Datenverlusten. Juristische Expertise muss daher frühzeitig in technische Entscheidungsprozesse eingebunden werden – nicht als Reaktion, sondern als präventive Governance-Struktur.
Hier ergänzt Dr. Peter Riedi mit ökonomischen tiefen Blick auf die Folgen: „DORA verändert nicht nur die Compliance, sondern die Kostenarchitektur der gesamten Finanzbranche. Digitale Resilienz ist kein IT-Projekt, sondern ein Bilanzthema. Die notwendigen Investitionen in Sicherheit, redundante Systeme und Krisenmanagement werden die Margen vieler Finanzdienstleister spürbar beeinflussen.“
Riedi sieht darin zugleich eine strategische Chance und ein wirtschaftliches Risiko: „Wer heute in robuste IT-Resilienz investiert, schafft morgen Vertrauen am Markt. Doch kleinere Anbieter und FinTechs geraten durch DORA unter Druck – sie müssen mit Großbanken konkurrieren, deren Budgets für Cybersicherheit um ein Vielfaches höher sind. Die Frage wird sein: Schafft Europa ein Resilienzsystem, das schützt – oder eines, das Konsolidierung erzwingt?“
Der Experte mahnt zugleich zu ökonomischer Weitsicht: „Cybersicherheit darf nicht nur als Kostenfaktor verstanden werden. Sie ist Teil des unternehmerischen Vermögenswerts – eine unsichtbare Reserve, die über Überleben oder Scheitern entscheidet.“
Damit bringt Riedi die Herausforderung auf den Punkt: DORA zwingt Unternehmen, Technologie, Recht und Wirtschaft neu zu denken. Zwischen juristischer Pflicht und ökonomischer Vernunft entsteht ein neues Gleichgewicht, eines, das die Zukunftsfähigkeit der europäischen Finanzlandschaft definieren wird.
Fazit und Ausblick – Zwischen Regulierung, Innovation und Vertrauen: Europas Finanzordnung im Wandel
Die Entwicklungen des Jahres 2025 machen eines unübersehbar: Die Finanzwelt steht an einem Wendepunkt. Europäische und nationale Aufsichtsrahmen greifen enger ineinander, während Technologie, Nachhaltigkeit und Sicherheit zu neuen Achsen der Finanzordnung werden. BaFin, EBA und AMLA bilden die juristische Frontlinie eines Systems, das Stabilität schaffen will – und zugleich gezwungen ist, wirtschaftliche Dynamik nicht zu ersticken.
Dr. Thomas Schulte bringt es auf den Punkt: „Juristinnen und Juristen dürfen nicht länger nur auf die Vergangenheit reagieren. Unsere Aufgabe ist es, den Wandel aktiv im Lichte des geltenden Rechts mitzugestalten.“
Damit spricht er ein Kernproblem moderner Finanzaufsicht an: Wie lässt sich Sicherheit ohne Stillstand, Kontrolle ohne Überregulierung erreichen? Zwischen künstlicher Intelligenz, digitaler Transformation und geopolitischen Unsicherheiten wächst die Verantwortung der Aufsicht, Rechtssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zugleich zu gewährleisten.
Dr. Peter Riedi ergänzt mit ökonomischer Präzision: „Regulierung ist kein Feind der Wirtschaft, sondern ihr Fundament – vorausgesetzt, sie bleibt realistisch. Zukunftsfähigkeit bedeutet, dass Sicherheit und Profitabilität nicht als Gegensätze, sondern als Partner gedacht werden. Ein stabiles System entsteht dann, wenn Innovation nicht bestraft, sondern begleitet wird.“
Beide Experten sind sich einig: Das Finanzsystem der Zukunft braucht Mut zur Balance. Rechtliche Klarheit muss mit wirtschaftlicher Vernunft und technologischer Offenheit verbunden werden. Europa hat mit der neuen Generation von Gesetzen – von DORA über KMAG bis AMLA – die Chance, nicht nur zu reagieren, sondern den globalen Standard für Sicherheit und Nachhaltigkeit im Finanzwesen zu setzen.
Für Unternehmen und Verbraucher bedeutet das: Rechtsbewusstsein wird zur Zukunftskompetenz. Wer rechtzeitig Strukturen anpasst, juristische Beratung integriert und ökonomische Realität mit regulatorischen Anforderungen versöhnt, sichert nicht nur seine Compliance – sondern auch sein Vertrauen am Markt.
Am Ende bleibt die Hoffnung, dass diese Welle an Reformen mehr ist als ein bürokratisches Update: ein neuer Gesellschaftsvertrag zwischen Wirtschaft, Recht und Technologie, in dem Stabilität und Fortschritt kein Widerspruch mehr sind – sondern das Fundament einer resilienten, zukunftsfähigen Finanzwelt.
Autor: Maximilian Bausch, B.Sc. Wirtschaftsingenieur
Maximilian Bausch ist Wirtschaftsingenieur, Autor und Blogger. Er schreibt über Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie – faktenbasiert, verständlich und zukunftsorientiert.
Kontakt:
Dr. iur. Thomas Schulte
Rechtsanwalt
Malteserstraße 170
12277 Berlin
dr.schulte@dr-schulte.de
Tel. 0049(0) 30 22 19 220 20
Fax 0049(0) 30 22 19 220 21