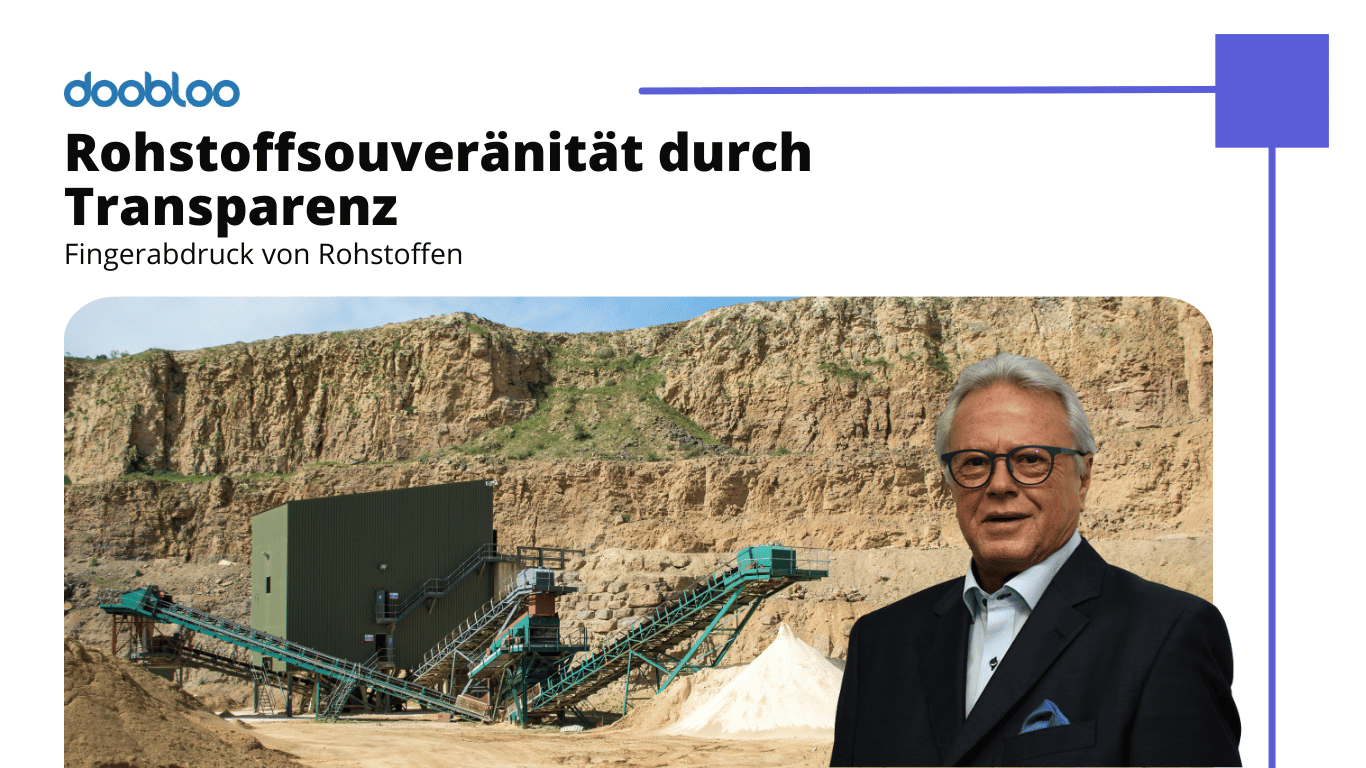Polizei Ludwigshafen setzt Zeichen gegen Raser in Ludwigshafen am Rhein, einer Stadt im Bundesland Rheinland-Pfalz. – von Valentin Markus Schulte, stud. iur.
Die Polizei in Ludwigshafen hat einem notorischen Raser die “Flügel” gestutzt. Ein Motorrad, das mit seinen 998 ccm und bis zu 285 km/h eher auf die Rennstrecke als auf öffentliche Straßen gehört, bleibt vorerst unter Verschluss. Grund: Sein Fahrer, ein junger Mann, der bereits mehrfach wegen illegaler Straßenrennen aufgefallen ist, rastete erneut aus und wurde von wachsamen Beamten gestoppt.
Mit Vollgas ins Visier der Polizei
Es war ein lauter Knall und ein blitzschnelles Hochschalten, das den beiden Streifenpolizisten mitten in Ludwigshafen auffiel. Eigentlich waren sie auf dem Weg zu einem Unfall, doch was sie sahen, ließ sie abrupt kehrtmachen: Zwei Motorräder donnerten mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn an ihnen vorbei. Während einer der Raser flüchtete, schnappte die Polizei den “Feuerstuhlraser“ an einer Ampel – und das Rennen war gelaufen.
Bereits aktenkundig: Kein unbeschriebenes Blatt
Wie sich herausstellte, war der junge Fahrer kein Unbekannter. Er stand schon mehrfach wegen Straßenrennen in den Schlagzeilen. Die Beamten ließen nichts anbrennen und konfiszierten das Highspeed-Gefährt präventiv, um weitere Gefahren für die Öffentlichkeit abzuwenden. Zudem war bekannt, dass der Fahrer zwei Jahre zuvor in einen ähnlichen Vorfall verwickelt war, bei dem er ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war und einen Unfall verursacht hatte.
Im Einsatzbericht wurde auch erwähnt, dass das Motorrad technisch für Rennen ausgelegt war und eine Höchstgeschwindigkeit von 285 km/h erreichen konnte. Die Polizei argumentierte, dass die Maschine den Fahrer zu weiteren Verstößen geradezu einlade und dass die Sicherstellung erforderlich sei, um weitere Gefährdungen im Straßenverkehr zu verhindern. Trotz lautstarker Proteste des Motorradfahrers blieb die Maschine in Polizeigewahrsam – und das aus gutem Grund, wie nun das Verwaltungsgericht Neustadt bestätigte.
Verkehrswidriges Fahren: Unter welchen Voraussetzungen kann das Fahrzeug von der Polizei weggenommen werden?
Die Sicherstellung eines Fahrzeugs ist eine schwerwiegende Maßnahme, die nur unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen zulässig ist. Grundsätzlich zielt sie darauf ab, weitere Gefährdungen im Straßenverkehr zu verhindern. Dabei greifen sowohl spezialrechtliche Regelungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) und des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) als auch allgemeine Bestimmungen des Polizeirechts. Ein solcher Eingriff muss verhältnismäßig sein und ist nur bei konkreten und gegenwärtigen Gefahren möglich.
Rechtliche Grundlagen und Voraussetzungen
Die Sicherstellung eines Fahrzeugs ist in den Polizeigesetzen der Länder geregelt, wie beispielsweise in § 43 PolG NRW oder Art. 25 BayPAG. Sie dient der Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr, also einer Situation, in der eine Verletzung von Rechtsgütern unmittelbar droht. Im Zusammenhang mit Verkehrsverstößen wird sie angewendet, wenn eine erhebliche Gefahr besteht, dass der Fahrer weitere schwere Verstöße begehen wird.
Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße stellte in seinem Urteil vom 14. Februar 2023 (Az. 5 K 692/22.NW) klar, dass eine Sicherstellung nur gerechtfertigt ist, wenn nachweisbare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Fahrzeugführer in naher Zukunft erneut Verkehrsverstöße begehen wird. Dabei genügt es nicht, allein auf vergangenes Fehlverhalten abzustellen. Eine konkrete Prognose über zukünftiges Verhalten ist erforderlich.
Verhältnis von Spezial- und Polizeirecht
Die Straßenverkehrsordnung ist ein spezialrechtliches Regelwerk, das den Straßenverkehr ordnet. Die Sicherstellung von Fahrzeugen fällt jedoch nicht in den Anwendungsbereich der StVO, da diese keine Regelungen zur Beschlagnahme enthält. Stattdessen greift das allgemeine Polizeirecht, wenn es darum geht, konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Dies wurde vom Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 20. Oktober 2015, Az. 3 C 15.14) bestätigt, das den Rückgriff auf polizeirechtliche Generalklauseln bei spezifischen Verkehrsverstößen als zulässig ansieht.
Konkrete und gegenwärtige Gefahr
Eine Sicherstellung ist nur möglich, wenn das Fahrzeug als Mittel künftiger Gefährdung betrachtet wird. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in einem Fall (Beschluss vom 23. Mai 2008, Az. 10 CS 08.1353) betont, dass die Maßnahme nicht repressiv sein darf, sondern präventiv wirken muss. Das bedeutet, sie dient nicht der Bestrafung vergangener Verstöße, sondern der Verhinderung weiterer Gefahren.
Ein anschauliches Beispiel hierfür liefert der Instanzenzug bezüglich des oben beschriebenen Falls (OVG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 30. April 2024, Az. 7 A 10988/23). Zur Erinnerung: Ein Motorradfahrer wurde verdächtigt, an einem illegalen Rennen teilgenommen zu haben. Die Polizei stellte sein Fahrzeug sicher, um die Wiederholung solcher Delikte zu verhindern. Das Gericht hob die Sicherstellung später auf, da keine ausreichenden Hinweise für eine konkrete Wiederholungsgefahr vorlagen. Allein die Tatsache, dass das Fahrzeug für Rennen geeignet war, reichte nicht aus.
Besondere Gefährdungslagen
In bestimmten Ausnahmefällen kann die Sicherstellung auch bei weniger schweren Verstößen gerechtfertigt sein. Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugführer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss steht oder wenn er weitere Verstöße ausdrücklich ankündigt. Eine erhebliche Wiederholungsgefahr kann auch dann angenommen werden, wenn der Fahrer wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Der Verwaltungsgerichtshof München (Urteil vom 26. Januar 2009, Az. 10 BV 08.1422) entschied, dass bei wiederholtem Fehlverhalten eines Verkehrsteilnehmers stärkere Eingriffe gerechtfertigt sein können, um Gefahren abzuwenden.
Ein anschauliches Beispiel
Ein Autofahrer wird mehrfach wegen massiver Geschwindigkeitsüberschreitungen auf einer Landstraße angehalten. Beim dritten Vorfall überschreitet er die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts um 60 km/h. Nach der Kontrolle setzt er seine Fahrt mit ähnlich hohen Geschwindigkeiten fort. Die Polizei beschließt, das Fahrzeug sicherzustellen, da der Fahrer weder Einsicht zeigt, noch bereit ist, sein Verhalten zu ändern.
Das Verwaltungsgericht bestätigt die Maßnahme, da das Verhalten des Fahrers eine konkrete Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Es argumentiert, dass der Fahrer unmittelbar nach der Kontrolle weitere Verstöße begangen hatte, was eine Wiederholungsgefahr belegt. Hier greift das Polizeirecht, da das System von Bußgeldern und Fahrverboten allein nicht ausreicht, um die Gefahr zu bannen.
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme
Eine Sicherstellung muss immer verhältnismäßig sein. Das bedeutet, dass mildere Mittel wie Verwarnungen oder Fahrverbote vorrangig geprüft werden müssen. Nur wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, darf auf die Sicherstellung zurückgegriffen werden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschied, dass der kurzzeitige Entzug eines Motorrads angemessen sein kann, wenn dies dazu beiträgt, Unfallschwerpunkte zu entschärfen (Beschluss vom 26. Januar 2009, Az. 10 BV 08.1422).
Die Sicherstellung eines Fahrzeugs bei verkehrswidrigem Fahren ist eine präventive Maßnahme, die nur unter strengen Voraussetzungen zulässig ist. Es muss eine konkrete und gegenwärtige Gefahr vorliegen, und die Maßnahme darf nur zur Abwehr künftiger Gefährdungen eingesetzt werden. Die Verhältnismäßigkeit ist dabei stets zu beachten. Polizei und Gerichte wägen sorgfältig ab, um einen Ausgleich zwischen Sicherheit im Straßenverkehr und den Rechten der Betroffenen zu schaffen.
Autor: Mgr. Valentin Schulte, Volkswirt B.Sc., stud. jur,
Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Thomas Schulte
Malteserstraße 170
12277 Berlin
Telefon: +49 30 221922020
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt in Berlin und leitender Vertrauensanwalt des Netzwerks ABOWI Law, unterstützt Sie bei rechtlichen Fragen und Problemen im Bereich digitaler Kommunikation, Vertragsrecht und moderner Missverständnisse. Insbesondere helfen wir bei der rechtlichen Einordnung von WhatsApp-Nachrichten, Emojis und deren Bedeutung in Vertragsverhandlungen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung, um rechtssichere Lösungen zu finden und Ihre Interessen zu wahren.