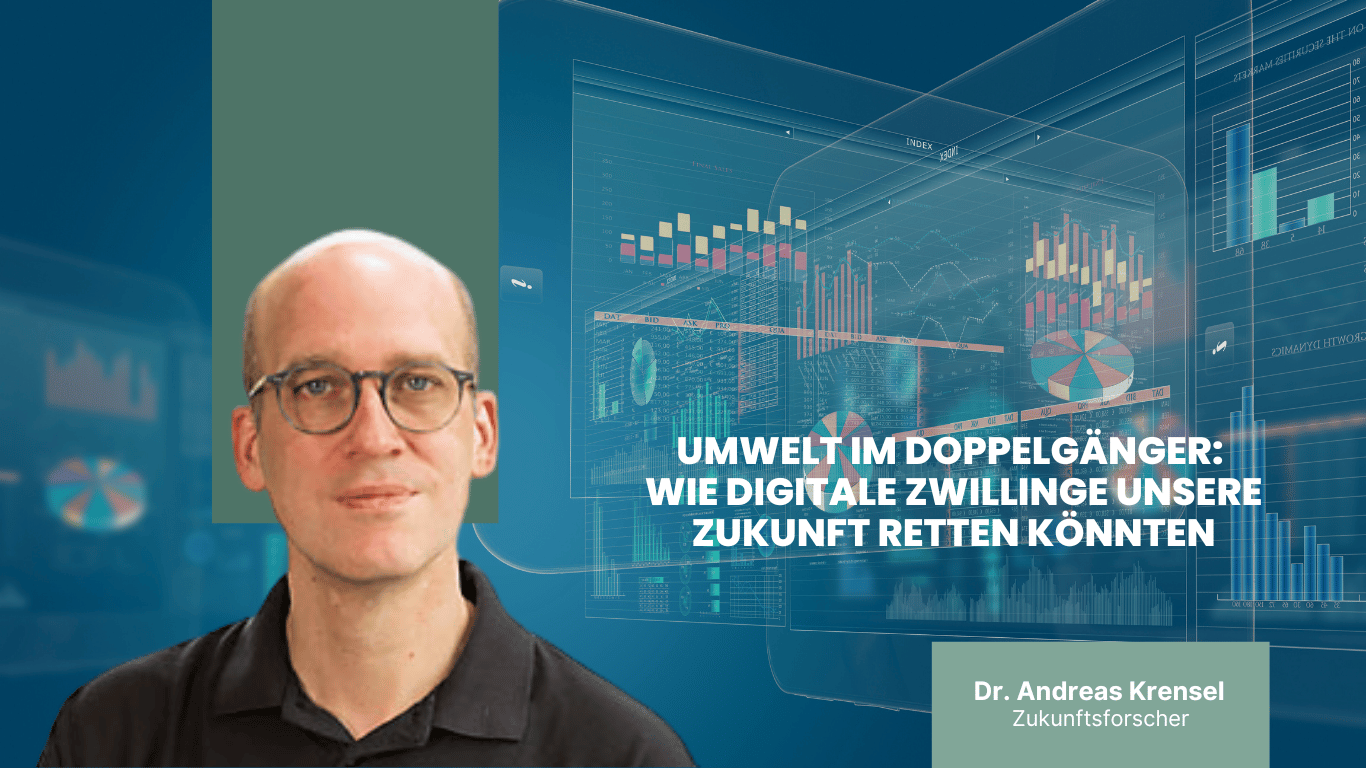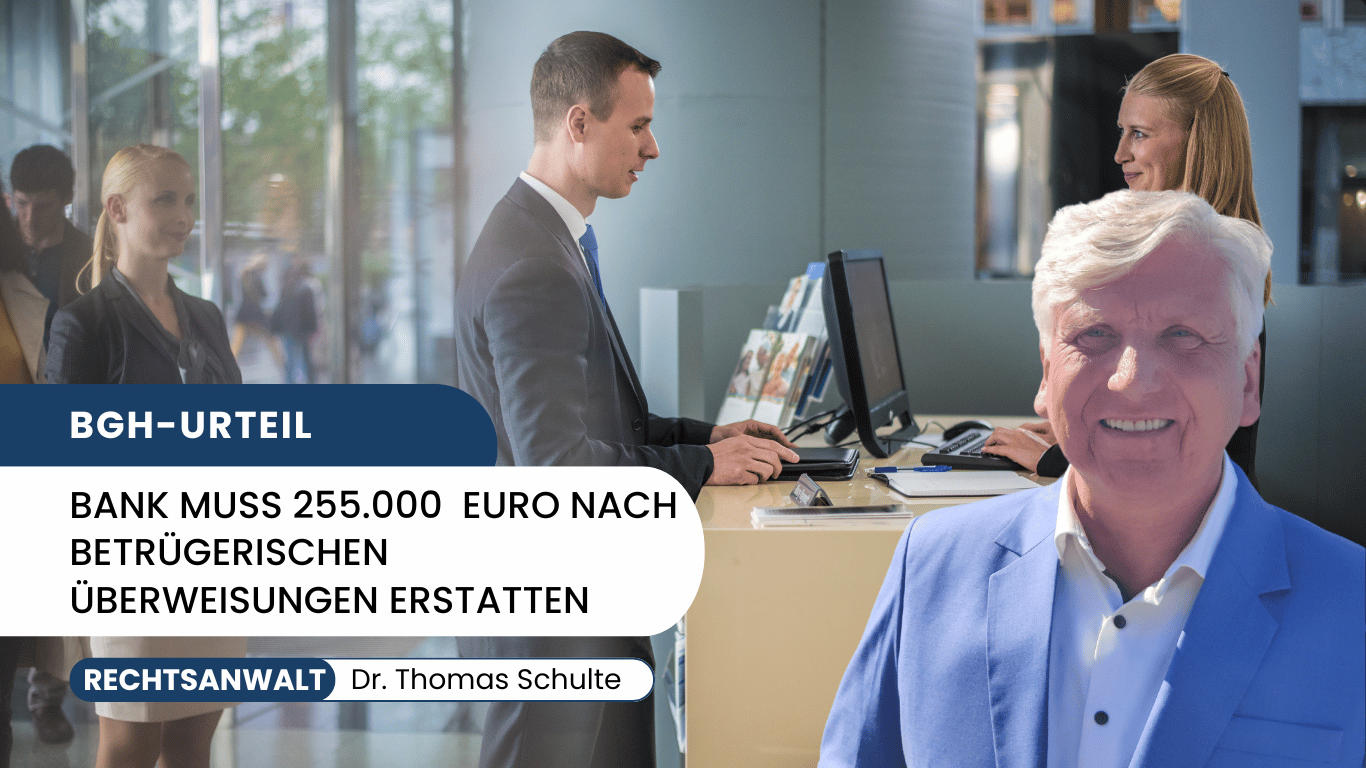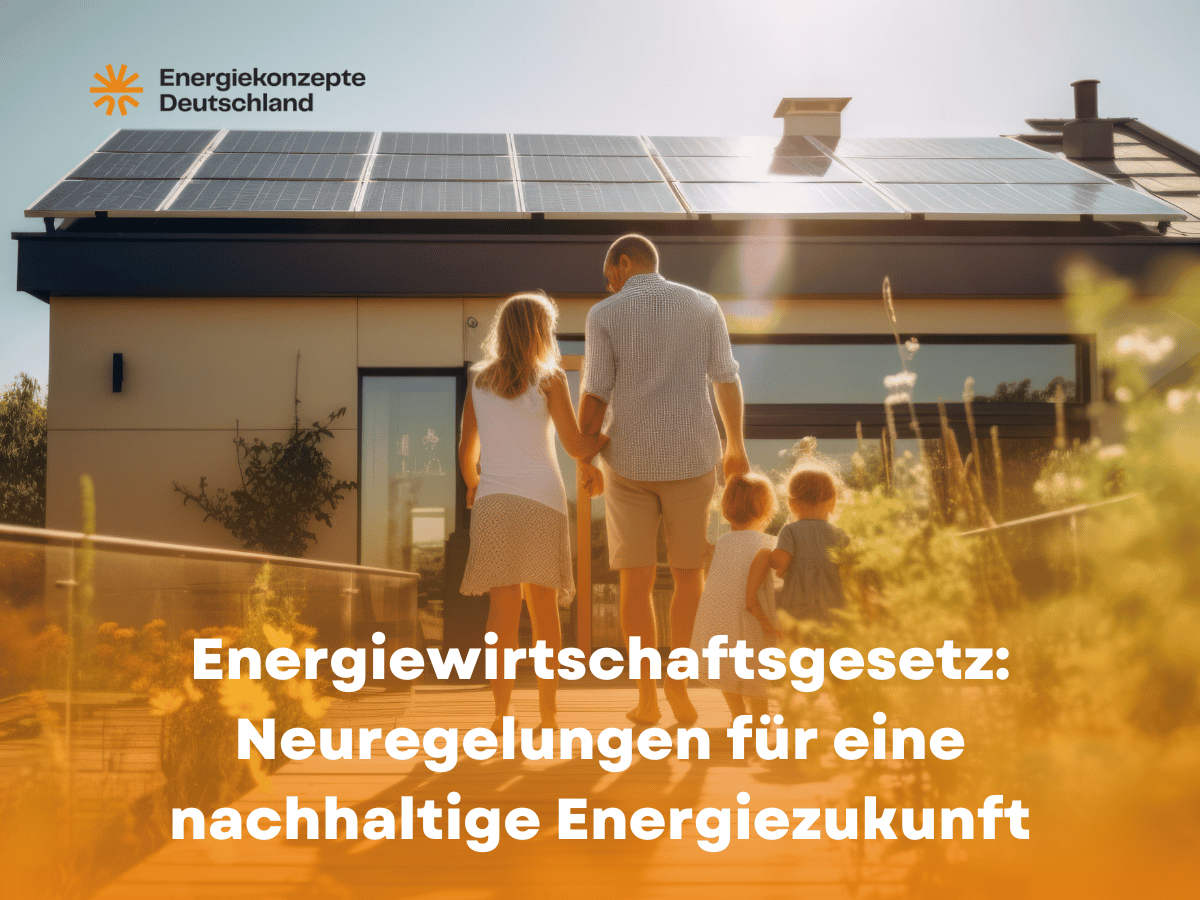Digitale Zwillinge und Umweltbewusstsein – wie virtuelle Abbilder unsere Welt nachhaltiger machen. Dr. Andreas Krensel über die Rolle von GIS, KI und Partizipation für eine lebenswerte Zukunft.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der wir Umweltprobleme sehen, bevor sie entstehen – und Lösungen entwickeln, bevor Schäden überhaupt eintreten. Straßen, Flüsse, Wälder und ganze Städte existieren nicht nur in der Realität, sondern auch als hochpräzise, lernfähige digitale Abbilder, die jede Veränderung in Echtzeit widerspiegeln. In diesen Digitalen Zwillingen lässt sich erleben, wie ein neuer Park das Stadtklima abkühlt, wie adaptive Beleuchtung die Sicherheit erhöht oder wie Hochwasserschutzmaßnahmen wirken, noch bevor der erste Regentropfen fällt. Es ist eine Zukunft, in der Daten und Technologien nicht nur Werkzeuge sind, sondern aktive Partner für Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Klimaschutz – und genau diese Zukunft beginnt jetzt.
Die virtuelle Kopie, die die reale Welt verändert
Stellen Sie sich vor, wir könnten jede Straße, jeden Fluss, jedes Gebäude und sogar jede Veränderung in unserer Umwelt in Echtzeit sehen, verstehen – und steuern. Keine träge Bürokratie, keine blinden Entscheidungen mehr, sondern Planung und Handeln auf Basis eines lebendigen, lernfähigen digitalen Abbilds unserer Welt. Genau hier setzen Digitale Zwillinge an. Sie sind weit mehr als bloße Simulationen – sie sind intelligente, dynamische Modelle der Realität, die auf präzisen Geoinformationssystemen (GIS) basieren und sich durch Künstliche Intelligenz stetig weiterentwickeln.
Laut einer Studie der Europäischen Kommission können offene, interaktive Umwelt-Zwillinge die Planungszeiten in Stadt- und Umweltprojekten um bis zu 30 Prozent verkürzen und gleichzeitig die Treffsicherheit von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Ressourceneffizienz um bis zu 45 Prozent steigern.
Vom statischen Modell zum lernenden Ökosystem
Dr. Andreas Krensel, Biologe, Systemdenker und Entwickler intelligenter Mobilitätslösungen, kennt diese Entwicklung aus erster Hand. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Lichttechnik der TU Berlin wirkte er im Projekt DIGINET-PS daran mit, wie sich adaptive Beleuchtung, Verkehrssensorik und digitale Simulationen in einer realen Stadtumgebung nahtlos verbinden lassen. Sein interdisziplinärer Ansatz vereint Biologie, Physik, Systemtheorie und KI – und er ist überzeugt: „Die Zukunft nachhaltiger Umweltpolitik wird nicht mehr nur auf Papier entworfen, sondern in virtuellen Laboren getestet, optimiert und erst dann in der physischen Welt umgesetzt.“
Die Entwicklung der Digitalen Zwillinge ist eine technologische Erfolgsgeschichte, die sich in vier klar unterscheidbare, aber eng miteinander verknüpfte Stufen gliedert – und jede Stufe bringt uns näher an das Ziel, unsere physische Welt nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu gestalten.
In der ersten Phase, der statischen Modellbildung, werden historische Daten gesammelt, verdichtet und in ein digitales Abbild der Realität übersetzt. Hier entstehen präzise 3D-Modelle von Gebäuden, Infrastrukturen oder Landschaften, die auf Messungen, Satellitenbildern und Vermessungsdaten basieren. Diese Modelle sind ein wertvolles Archiv, aber sie zeigen nur eine Momentaufnahme – so, als würde man ein Foto machen, das schon im Moment der Aufnahme zu altern beginnt.
Die zweite Phase macht den entscheidenden Sprung zur dynamischen Aktualität. Jetzt fließen kontinuierlich Echtzeitdaten aus Sensoren, Drohnen, Satelliten oder IoT-Geräten in das Modell ein. Dadurch spiegelt der Digitale Zwilling nicht nur die Realität wider, sondern hält Schritt mit jeder Veränderung – sei es der Anstieg der Wassertemperatur in einem Fluss, das Verkehrsaufkommen in einer Stadt oder die Auslastung eines Stromnetzes.
In der dritten Phase wird der Digitale Zwilling prädiktiv. Durch Mustererkennung und den Einsatz von Algorithmen aus dem Bereich des Machine Learning analysiert er historische und aktuelle Daten gleichzeitig, um Prognosen zu erstellen. Plötzlich kann er vorhersagen, wie sich die Luftqualität in den nächsten 48 Stunden entwickeln wird, welche Straßenabschnitte bei Starkregen überflutet werden oder wann sich Engpässe im Energieverbrauch anbahnen. Diese vorausschauende Fähigkeit verwandelt den Zwilling von einem passiven Beobachter in einen aktiven Berater für Planer, Behörden und Unternehmen.
Die vierte Phase schließlich ist die der autonomen Reaktion. Hier übernimmt Künstliche Intelligenz die Rolle des Entscheidungsträgers und leitet eigenständig Maßnahmen ein, um negative Entwicklungen zu verhindern – ohne dass ein menschlicher Operator eingreifen muss. Das kann bedeuten, dass adaptive Straßenbeleuchtung automatisch so reguliert wird, dass sie Energie spart und zugleich die Sicherheit erhöht, oder dass ein Hochwasserschutzsystem Schleusen schließt, noch bevor der Pegel kritisch steigt. In dieser Stufe wird der Digitale Zwilling zu einem lernfähigen, handlungsorientierten System, das nicht nur informiert, sondern direkt wirkt – und damit den Schritt von der reinen Simulation zur intelligenten Steuerung vollzieht.
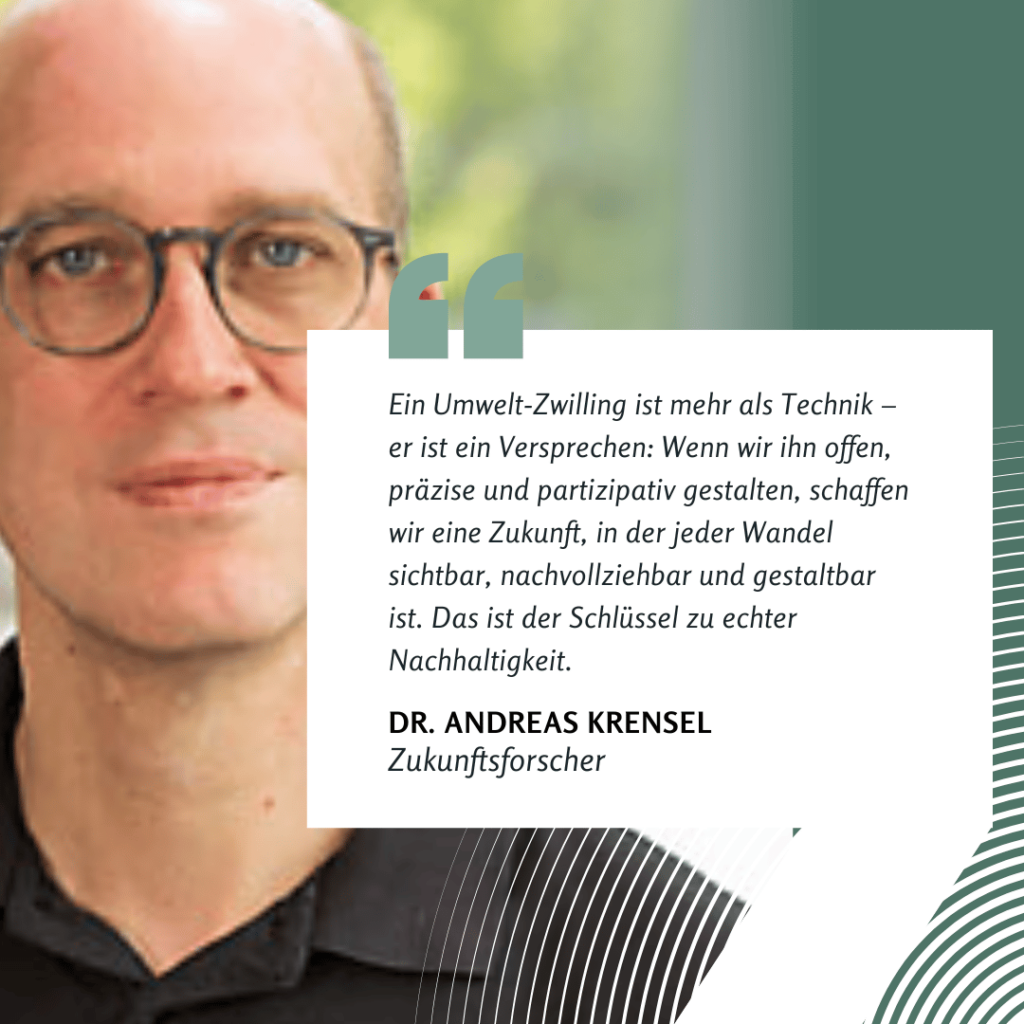
Offene Umwelt-Zwillinge – der Katalysator für Bewusstsein und Beteiligung
Ein entscheidender Schritt in Richtung Nachhaltigkeit sind offene Umwelt-Zwillinge. Sie geben nicht nur Politik und Industrie Zugriff auf hochpräzise Umweltdaten, sondern öffnen sie auch für Bürger, NGOs und Forschungseinrichtungen. Das bedeutet: Jeder kann sehen, wie sich Feinstaubwerte in seinem Viertel verändern, wo sich Hitzeinseln bilden oder wie sich der Niederschlag in den vergangenen zehn Jahren verschoben hat. In Amsterdam nutzt die Stadtverwaltung bereits ein solches System, um Hitzeschutzmaßnahmen zu planen – und bindet die Bevölkerung in Echtzeit über öffentliche Dashboards ein. Ergebnis: höhere Akzeptanz von Maßnahmen und schnellere Umsetzung.
Dr. Krensel sieht hier nicht nur einen technologischen, sondern auch einen gesellschaftlichen Mehrwert: „Transparenz ist der Schlüssel zu Akzeptanz. Wenn Menschen sehen, verstehen und mitgestalten können, wird Umweltschutz von der abstrakten Pflicht zur gelebten Gemeinschaftsaufgabe.“
Echtzeitdaten und prädiktive Analysen – proaktiv statt reaktiv handeln
Die Kombination aus Echtzeit-Sensordaten und KI-gestützten Analysen erlaubt es, Umweltveränderungen nicht nur zu registrieren, sondern auch vorherzusagen. Studien des Fraunhofer-Instituts zeigen, dass sich mit solchen Systemen bis zu 60 Prozent der Schäden durch Starkregen vermeiden lassen, wenn präventive Maßnahmen rechtzeitig ausgelöst werden.
In Helsinki etwa simuliert ein Digitaler Zwilling die Auswirkungen von Starkregen auf das gesamte Kanalnetz. Wenn kritische Werte erreicht werden, werden automatische Umleitungen aktiviert und Pumpwerke hochgefahren – noch bevor der erste Keller vollläuft.
Transparente Planung – der Hebel für eine nachhaltige Stadtentwicklung
Ob es um den Bau neuer Radwege, die Anlage von Grünflächen oder die Einführung adaptiver Straßenbeleuchtung geht – Digitale Zwillinge ermöglichen eine präzise Abwägung zwischen ökologischen, sozialen und ökonomischen Faktoren.
Sie machen sichtbar, wie eine neue Solaranlage den Energiebedarf eines Stadtteils senkt, wie ein Baumgürtel die Feinstaubbelastung reduziert oder wie sich die Verkehrssicherheit verändert, wenn Kreuzungen smarter beleuchtet werden.
Zukunftsvision: Das vernetzte Europa der Umwelt-Zwillinge
Stellen Sie sich Europa im Jahr 2050 vor: Von Lissabon bis Helsinki, von Dublin bis Athen ist der Kontinent durch ein unsichtbares, aber hochpräzises Nervensystem verbunden – die offenen Umwelt-Zwillinge. Jede größere Stadt betreibt ihr eigenes digitales Abbild, gespeist aus Milliarden von Sensordaten, Satellitenaufnahmen und Bürgerbeiträgen. Diese digitalen Zwillinge sind nicht nur Datenbanken, sondern lebendige Spiegelbilder der Realität, die in Echtzeit Auskunft über Klima, Mobilität, Ressourcenfluss, Energieverbrauch und Umweltbelastungen geben.
Die Infrastrukturen sind längst nicht mehr starr, sondern lernfähig. Adaptive Straßenlaternen dimmen ihr Licht automatisch, wenn Fledermäuse in der Nähe fliegen, um deren Orientierung nicht zu stören. Gleichzeitig leuchten sie stärker auf, wenn sich ein Radfahrer oder Fußgänger nähert – Sicherheit und Naturschutz gehen hier Hand in Hand. Intelligente Verkehrsleitsysteme analysieren permanent Luftqualität und Verkehrsfluss und lenken den Autoverkehr so, dass Feinstaubbelastungen in Wohngebieten um bis zu 40 % sinken. Wenn in Paris ein ungewöhnlich hoher Ozonwert gemessen wird, wird der Verkehrsfluss automatisch angepasst, zusätzliche Begrünungsanlagen werden aktiviert, und die Bevölkerung erhält in Sekunden präzise Handlungsempfehlungen auf ihre Smartphones.
Bildung und Bürgerbeteiligung sind tief in dieses System integriert. Schulklassen unternehmen Exkursionen nicht nur in den Park um die Ecke, sondern in digitale Abbilder ihrer gesamten Stadt, in der sie in Echtzeit die CO₂-Bilanz einzelner Stadtteile analysieren oder simulieren, wie sich mehr Grünflächen auf das Mikroklima auswirken würden. Bürger können per App über die Gestaltung neuer Grünzonen abstimmen, Bauprojekte kommentieren und deren Umweltfolgen live im Digitalen Zwilling nachvollziehen. Entscheidungen sind transparent dokumentiert – von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung – und können jederzeit von jedem Bürger überprüft werden.
Auch im Katastrophenschutz entfalten Umwelt-Zwillinge ihre volle Wirkung: Wenn Starkregen in Süddeutschland vorhergesagt wird, werden in Sekundenbruchteilen Rückhaltebecken automatisch geöffnet, Flusspegel überwacht und Evakuierungspläne aktiviert. In Küstenstädten können Sturmflut-Barrieren hochfahren, bevor der erste Windstoß eintrifft – gesteuert durch die prädiktiven Fähigkeiten der Digitalen Zwillinge.
Dr. Andreas Krensel bringt es auf den Punkt: „Ein Europa, in dem offene Umwelt-Zwillinge Standard sind, ist ein Europa, das nicht mehr reaktiv, sondern proaktiv handelt. Wenn wir jetzt investieren und die Systeme konsequent aufbauen, schaffen wir die Grundlage für einen klimaneutralen Kontinent, der nicht nur lebenswerter, sondern auch technologisch souverän ist.“
Das Bild von Europa 2050 ist damit nicht nur eine technologische Vision, sondern eine Einladung: zu mehr Transparenz, gemeinsamer Verantwortung und einer intelligent vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne – vom Schüler bis zum Bürgermeister – aktiv am Umweltschutz teilnimmt.
Autor: Maximilian Bausch, Wirtschaftsingenieur
Kontakt:
eyroq s.r.o.
Uralská 689/7
160 00 Praha 6
Tschechien
E-Mail: info@eyroq.com
Web:https://wagner-science.de
Über eyroq s.r.o.:
Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.
Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozial verträglich und ethisch reflektiert sind.
Pressekontakt:
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com
Über Dr. Andreas Krensel:
Dr. rer. nat. Andreas Krensel ist Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler mit Fokus auf digitaler Transformation undangewandtere Zukunftsforschung. Seine Arbeit vereint Erkenntnisse aus Physik, KI, Biologie und Systemtheorie, um praxisnahe Lösungen für Industrie, Stadtentwicklung und Bildung zu entwickeln. Als interdisziplinärer Vordenker begleitet er Unternehmen und Institutionen dabei, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz durch Digitalisierung, Automatisierung und smarte Technologien zu steigern. Zu seinen Spezialgebieten zählen intelligente Lichtsysteme für urbane Räume, Lernprozesse in Mensch und Maschine sowie die ethische Einbettung technischer Innovation. Mit langjähriger Industrieerfahrung – unter anderem bei Mercedes-Benz, Silicon Graphics Inc. und an der TU Berlin – steht Dr. Krensel für wissenschaftlich fundierte, gesellschaftlich verantwortungsvolle Technologiegestaltung.