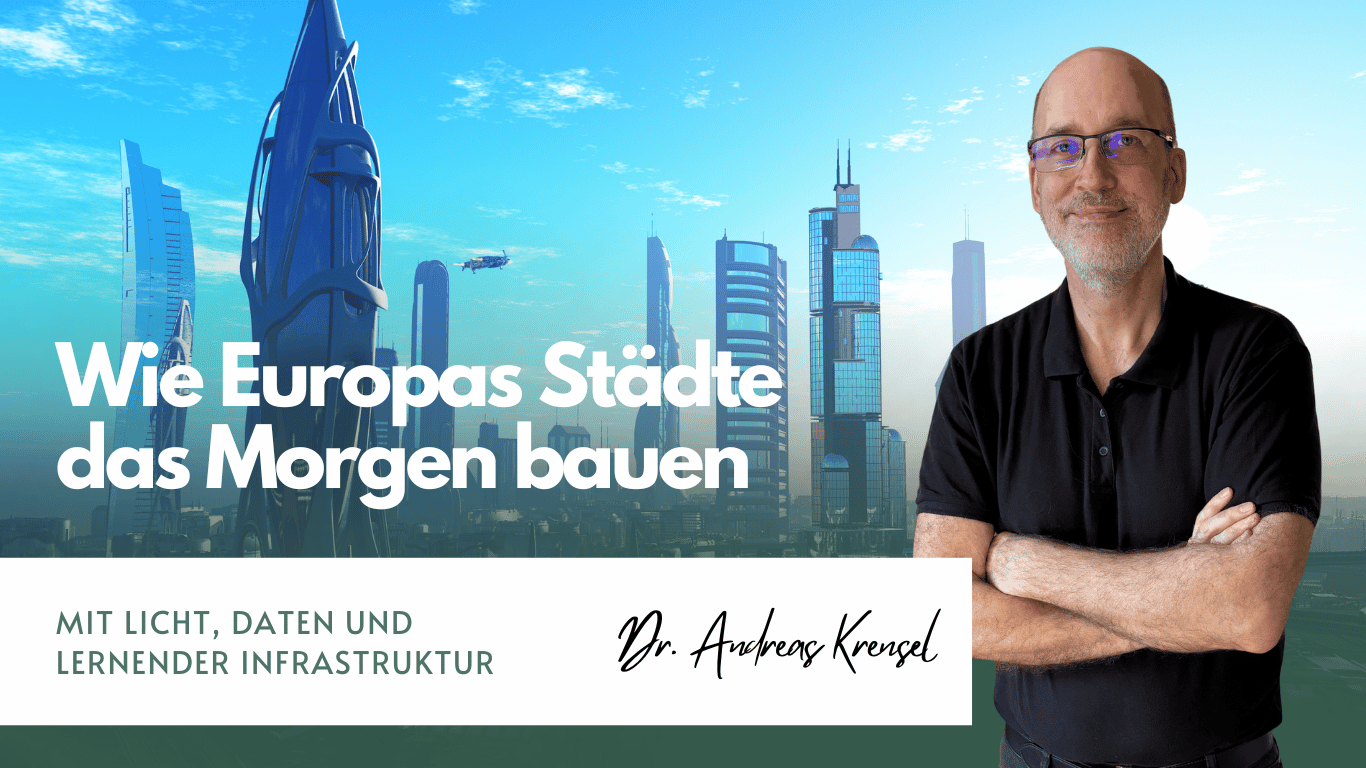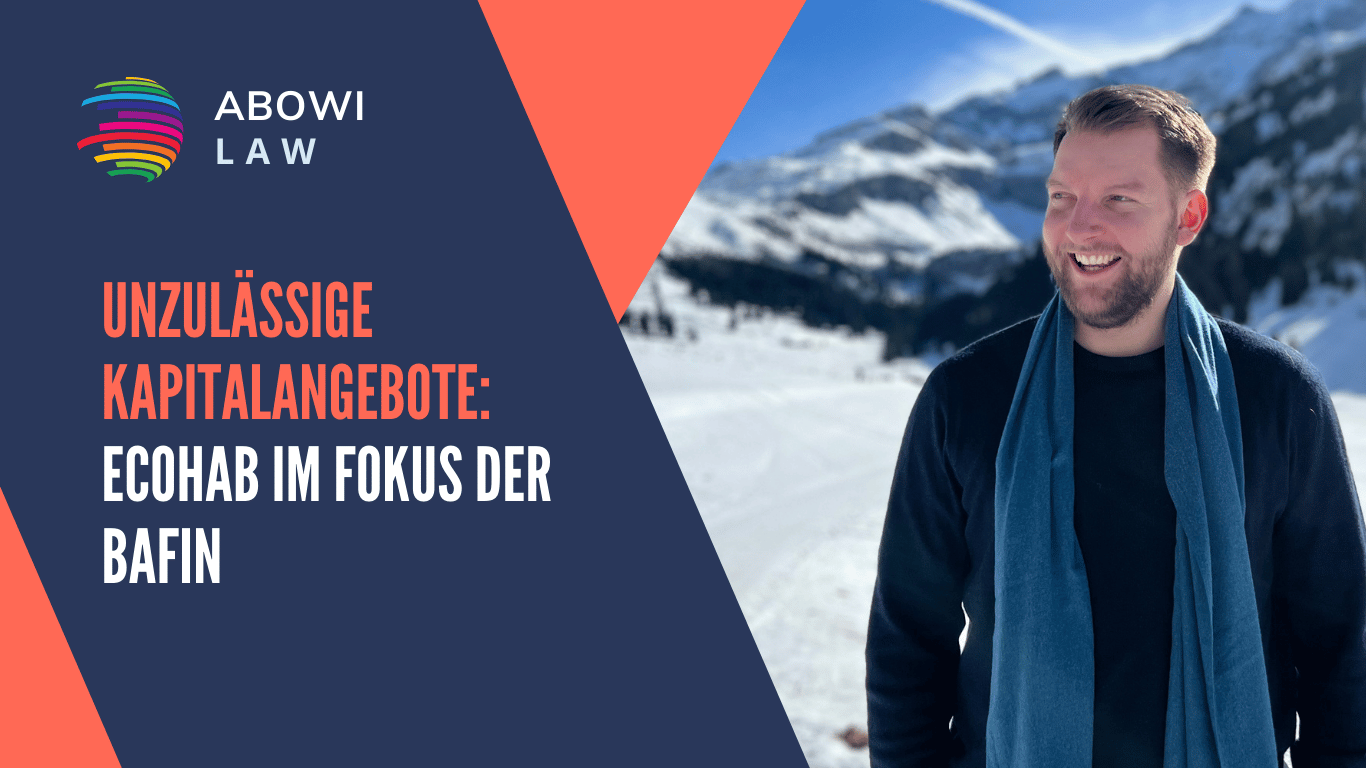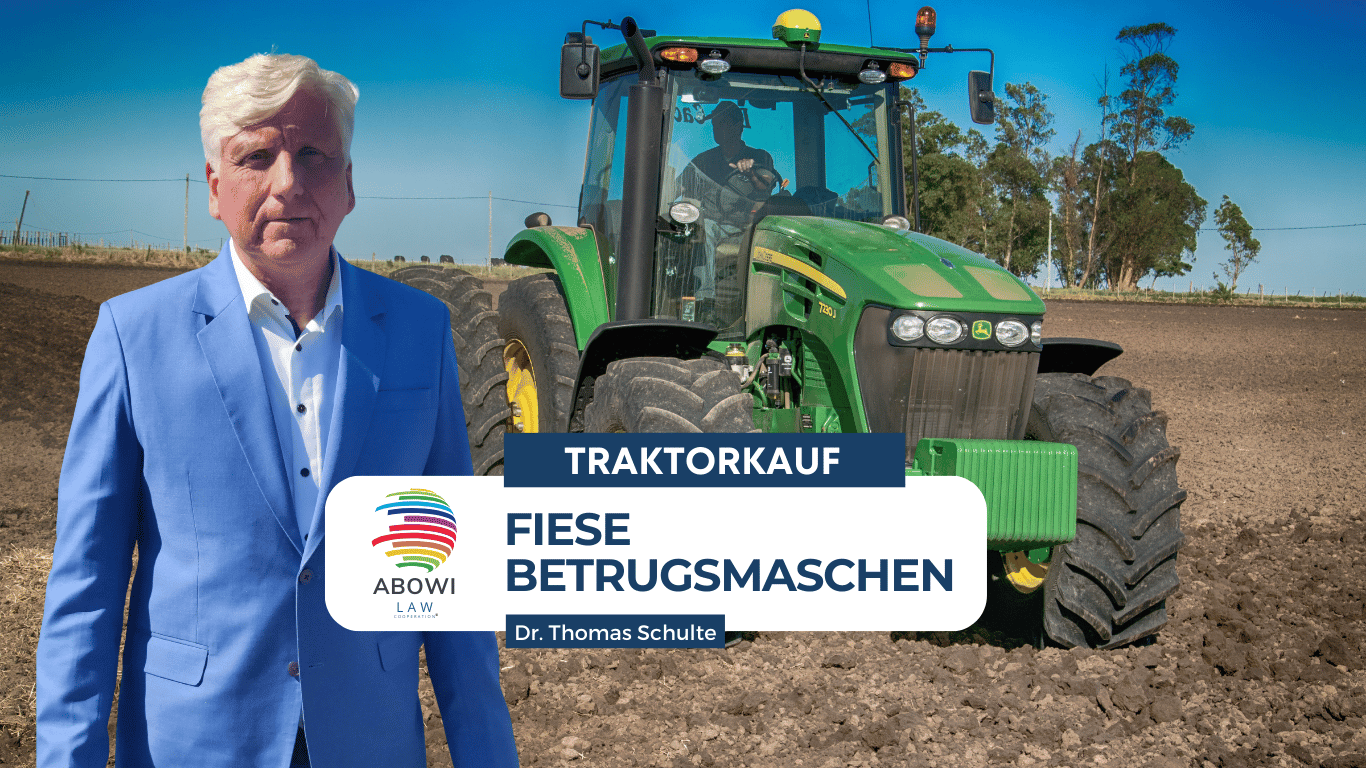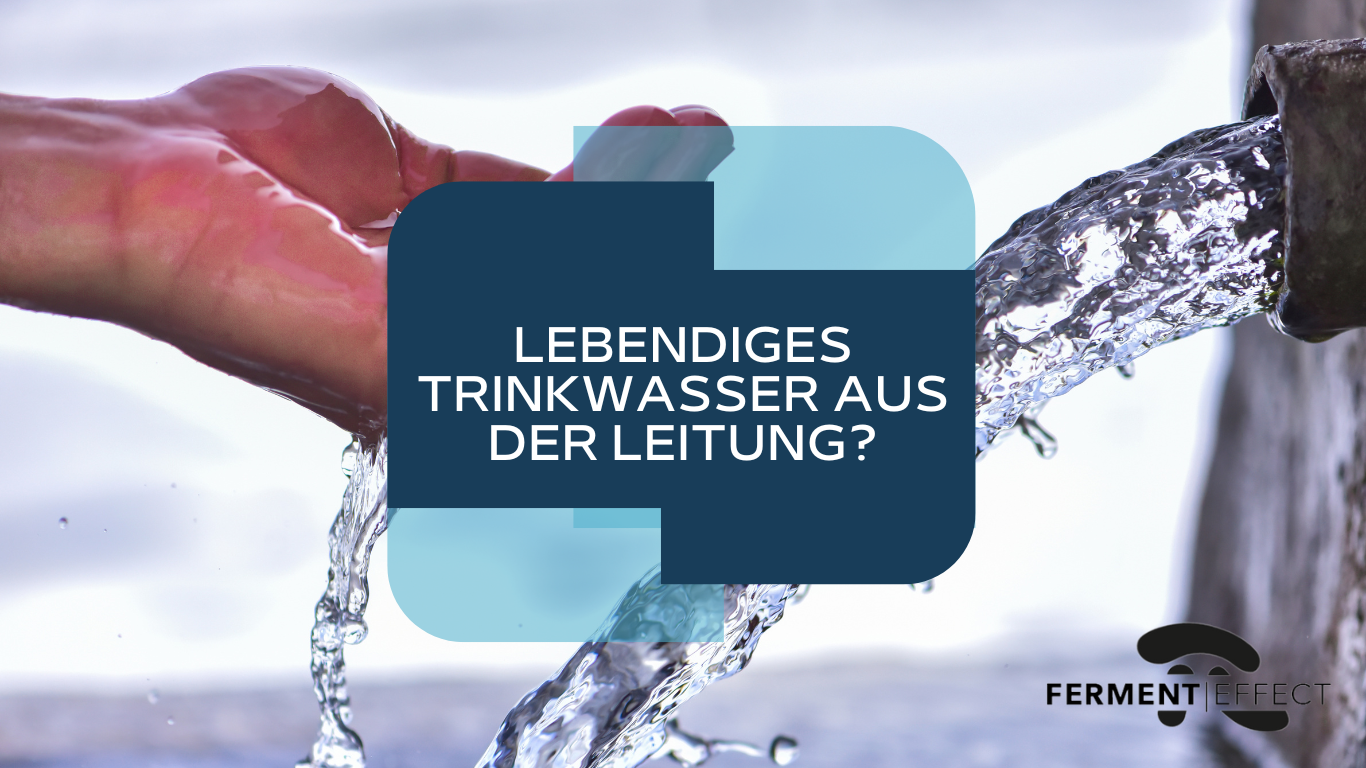Die Zukunft der Stadt beginnt nicht mit einer neuen Skyline, sondern mit einer neuen Denkweise: Morgenstadt ist weniger ein Bauprojekt als ein Betriebssystem für Urbanität. Die Fraunhofer‑Initiative „Morgenstadt“ versteht Städte als komplexe, lebendige Systeme, in denen Energie, Mobilität, Wasser, Gebäude, Daten und Governance ineinandergreifen – und in Reallaboren iterativ verbessert werden. Seit 2012 bringt das Netzwerk Kommunen, Institute und Unternehmen zusammen, entwickelt City‑Labs, Indizes und Roadmaps und übersetzt Forschung in umsetzbare Maßnahmen. Der Anspruch: aus Visionen messbare Ergebnisse machen – von der CO₂‑armen Wärmeversorgung bis zur lärmärmeren Mobilität, von der zirkadian klugen Beleuchtung bis zum digitalen Zwilling des Quartiers.
Warum diese Systemperspektive jetzt zur Grundausstattung gehört, erklärt ein Blick auf die Fakten. Weltweit leben heute deutlich mehr als die Hälfte der Menschen in Städten; bis 2050 werden es voraussichtlich rund 68 Prozent sein. Allein in Europa treibt die Urbanisierung Energie‑, Flächen‑ und Gesundheitsfragen auf engem Raum zusammen. Genau deshalb koppelt die EU ihre Klimaziele an konkrete Stadtpfade: 100 europäische Mission‑Städte sollen bis 2030 klimaneutral und smart werden – als Experimentier‑ und Investitionsräume, von denen alle anderen bis 2050 profitieren. Dahinter stehen inzwischen handfeste Förderrunden und eine wachsende Investitionspipeline; Berechnungen rund um die Mission sprechen von dreistelligen Milliardenbeträgen, die in die kommunale Transformation fließen müssen.
Das Reallabor als Regelkreis: Dr. Andreas Krensels Blick auf die lernende Stadt
Der Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler Dr. Andreas Krensel ergänzt den Morgenstadt‑Ansatz um einen präzisen Regelkreis: Messen, Modellieren, Handeln – und Iterieren. Sein Werkzeugkasten verbindet Physik, KI, Biologie und Systemtheorie. Zuerst werden Ziele scharfgestellt – Gesundheit, Sicherheit, Artenvielfalt, Energie –, dann werden Hypothesen im Stadtraum getestet, Sensordaten in Echtzeit ausgewertet, und digitale Zwillinge simulieren die Wirkung, bevor teure Fehlentscheidungen betoniert werden. So wird die Stadt zum „Athleten“, der mit jeder Saison besser spielt: adaptive Beleuchtung, die Energiekosten senkt und zugleich die Nachtökologie schont; Mobilitätssteuerung, die Lärmspitzen glättet; Wasserkreisläufe, die Abwasser zu Energie machen. Die Methode passt perfekt zur Morgenstadt‑Logik der Fraunhofer‑City‑Labs, die vor Ort Daten und Stakeholderwissen bündeln und daraus eine integrierte Roadmap entwickeln.
Licht als Betriebssystem: Intelligente Beleuchtung, Gesundheit und Energie
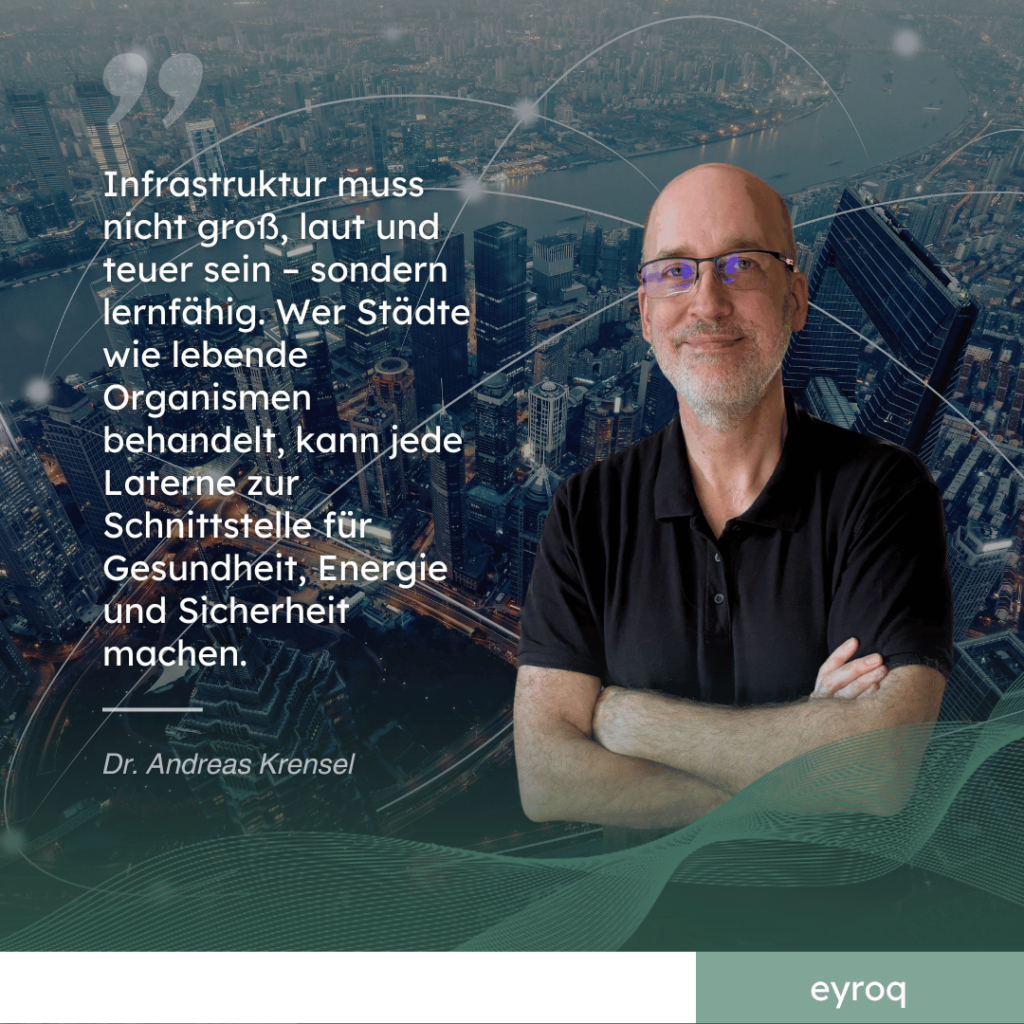 Straßenbeleuchtung ist in vielen Kommunen der größte einzelne Stromposten – und zugleich der schnellste Hebel, um Effizienz, Sicherheit und Biodiversität zusammenzubringen. Europaweite Analysen zeigen: Städte geben häufig 20 Prozent und mehr ihrer Energiekosten für Licht aus; in manchen Kommunen liegt der Anteil des öffentlichen Lichts am Strombudget bei 30 bis 50 Prozent. Der Umstieg auf LED halbiert typischerweise den Verbrauch, adaptive Dimmung und bedarfsgesteuerte Steuerung heben weitere zweistellige Prozentpunkte. Das ist nicht nur Haushaltsentlastung, sondern Gesundheitspolitik: weniger Blend- und Treulicht, bessere Dunkelkorridore, mehr subjektive Sicherheit nach Bedarf statt Dauer‑Volllicht. Und es ist Biologie: Die Internationale Beleuchtungskommission (CIE) empfiehlt „proper light at the proper time“ – nachts wärmer, abgeschirmter, gezielter. Genau diese Prinzipien lassen sich heute technisch sauber umsetzen und in Normen und Betriebsstrategien überführen.
Straßenbeleuchtung ist in vielen Kommunen der größte einzelne Stromposten – und zugleich der schnellste Hebel, um Effizienz, Sicherheit und Biodiversität zusammenzubringen. Europaweite Analysen zeigen: Städte geben häufig 20 Prozent und mehr ihrer Energiekosten für Licht aus; in manchen Kommunen liegt der Anteil des öffentlichen Lichts am Strombudget bei 30 bis 50 Prozent. Der Umstieg auf LED halbiert typischerweise den Verbrauch, adaptive Dimmung und bedarfsgesteuerte Steuerung heben weitere zweistellige Prozentpunkte. Das ist nicht nur Haushaltsentlastung, sondern Gesundheitspolitik: weniger Blend- und Treulicht, bessere Dunkelkorridore, mehr subjektive Sicherheit nach Bedarf statt Dauer‑Volllicht. Und es ist Biologie: Die Internationale Beleuchtungskommission (CIE) empfiehlt „proper light at the proper time“ – nachts wärmer, abgeschirmter, gezielter. Genau diese Prinzipien lassen sich heute technisch sauber umsetzen und in Normen und Betriebsstrategien überführen.
Digitale Zwillinge: Vom Mast ins Modell – und zurück in die Straße
Digitale Zwillinge werden zur Schaltzentrale der Morgenstadt. Sie verschneiden Sensordaten aus Beleuchtung, Luft und Lärm mit Verkehrs‑, Wetter‑ und Gebäudedaten, simulieren Szenarien und spielen optimierte Steuerungen zurück in den Betrieb. Helsinki zeigt, wie das skaliert: Die Stadt arbeitet mit einem offenen 3D‑Stadtmodell als digitalem Zwilling, der bis zum „Energy & Climate Atlas“ reicht – ein Werkzeug, das Dach‑Solarpotenziale, Lärmausbreitung oder Überflutungsrisiken auf Gebäudeebene sichtbar macht und Entscheidungen beschleunigt. Mit der 2024 beschlossenen EDIC „Local Digital Twins & CitiVERSE“ schafft die EU zudem eine gemeinsame Infrastruktur, um lokale Zwillinge über Ländergrenzen hinweg zu vernetzen und zu standardisieren – ein Durchbruch, der Beschaffung, Datenaustausch und Reproduzierbarkeit erleichtert.
Gebäude als Klimamaschinen: Renovation Wave und EPBD‑Recast
Wer Morgenstadt ernst nimmt, muss am größten Hebel ansetzen: dem Bestand. 85 Prozent der EU‑Gebäude sind vor 2000 entstanden, rund 75 Prozent haben eine schwache Energieperformance, und die Renovierungsrate liegt noch bei etwa 1 Prozent. Das erklärt, warum die revidierte EU‑Gebäuderichtlinie (EPBD, 2024/1275) so scharf nachsteuert und die „Renovation Wave“ zentrale Priorität bleibt: Gebäude verursachen um die 40 Prozent des Energieverbrauchs und etwa 36 Prozent der energiebezogenen Emissionen in der EU. Für Morgenstadt‑Städte heißt das: Energetische Sanierung wird zum Fundament, smarte Gebäudetechnik zum Beschleuniger und der digitale Zwilling zum Nachweis‑Werkzeug, das Wirkung, Kosten und Komfort zusammenführt – von der Fassade bis zur Wärmepumpe, von der Nutzerlenkung bis zur Flexibilisierung lokaler Netze.
Wasser neu denken: DEUS 21 und die semi‑dezentrale Stadt
Morgenstadt ist Kreislaufdenken. Das zeigen Fraunhofer‑Projekte wie DEUS 21, die in Knittlingen bei Pforzheim demonstriert haben, wie ein semi‑dezentrales Wasser‑ und Abwassermanagement Trinkwasser spart, Abwasser biologisch reinigt und organische Bestandteile in Biogas überführt. Regenwasser wird qualitätsgesichert gesammelt, gereinigt und als Brauchwasser nutzbar gemacht; Vakuumkanalisation reduziert Wasserverbrauch und Transportaufwand. Für schnell wachsende Städte ist das mehr als Technik: Es ist Resilienz gegen Trockenstress, Starkregen und Preisschocks – integrierbar in den digitalen Zwilling, messbar im Betrieb, skalierbar über Quartiere hinweg.
Urbane Ernährung als Energie‑ und Gesundheitsfrage: inFARMING®
Zur Morgenstadt gehört auch die Nähe von Produktion und Konsum. Fraunhofer UMSICHT entwickelt mit inFARMING® urbane Landwirtschaftssysteme, die Dächer, Fassaden und Gebäudeinfrastruktur einbeziehen, Stoffströme koppeln und lokale Frischeproduktion ermöglichen – von CO₂‑Nutzung bis Grauwasseraufbereitung. Für die Stadt ergibt sich ein Dreiklang: kurze Wege, weniger Kühl‑ und Verpackungsbedarf, und belastbare Daten über Erträge, Verbräuche und Gesundheitseffekte. So wird das Stadtgrün vom „Nice to have“ zum messbaren Baustein von Klima‑, Ernährungs‑ und Lebensqualitätszielen.
Gesundheit als Leitgröße: Luft, Lärm – und die neue EU‑Regelung
Morgenstadt ist Gesundheitsstrategie. Die Europäische Umweltagentur zeigt, dass 2022/2023 noch immer der überwiegende Teil der städtischen Bevölkerung Feinstaubbelastungen über WHO‑Richtwerten ausgesetzt war; zugleich hat die EU 2024 die Luftqualitätsregeln verschärft: Bis 2030 sinken die Jahresgrenzwerte etwa für PM2,5 von 25 µg/m³ auf 10 µg/m³ und für NO₂ von 40 µg/m³ auf 20 µg/m³, flankiert von stärkeren Bürgerrechten und Monitoring‑Pflichten. Beim Lärm spricht der neue EEA‑Bericht von über 110 Millionen Europäerinnen und Europäern, die chronisch schädlichem Verkehrslärm ausgesetzt sind – mit geschätzten 66 000 vorzeitigen Todesfällen jährlich. Für Morgenstadt‑Städte sind das keine abstrakten Zahlen, sondern harte KPI‑Ziele, die sich mit Sensorik, digitalen Zwillingen und intelligenter Mobilitäts‑ und Lichtsteuerung direkt adressieren lassen.
Vom Leuchtturm zur Serie: Mission‑Städte, Kapitalhub und Skalierung
Die EU‑Mission „100 klimaneutrale und smarte Städte“ fungiert als Skalierungsmaschine: Sie legt Klimapläne auf, prüft Investitions‑Roadmaps und öffnet den Zugang zu Kapital – bis zum „Climate City Capital Hub“, der Projekte bündel‑ und bankfähig macht. Inzwischen haben Dutzende Städte ihre Pläne bestätigt bekommen; der Investitionsbedarf bis 2030 liegt nach Schätzungen im hohen dreistelligen Milliardenbereich. Damit verschiebt sich Morgenstadt von der Projekt‑ zur Portfolio‑Logik: Kommunen definieren thematische „Pipelines“ – etwa Gebäudesanierung, smarte Beleuchtung, grüne Korridore, Wasser – und heben Synergien, die man einzeln nie finanzieren könnte.
Hammarby, Helsinki, Handbuch: Was die Pioniere vormachen
Wer wissen will, wie Systemdenken in der Praxis aussieht, schaut nach Skandinavien. Hammarby Sjöstad in Stockholm hat früh gezeigt, wie ein „urbaner Metabolismus“ Wasser, Energie, Abfall und Mobilität koppelt – mit dem Anspruch, den ökologischen Fußabdruck des Quartiers gegenüber konventionellen Lösungen drastisch zu senken. Helsinki demonstriert parallel die Kraft eines offenen, stadtweiten digitalen Zwillings, der Energie‑, Klima‑ und Lärmdaten auf einer Plattform zusammenführt und Entscheidungen beschleunigt. Morgenstadt greift genau solche Pionierarbeiten auf, standardisiert Methoden in City‑Labs und City‑Indizes und macht aus Einzel‑Cases eine Blaupause für europäische Breite.
Die Kultur des Lernens: Governance als Ausdauerdisziplin
Morgenstadt ist weniger ein Sprint als eine Serie kluger Ballwechsel. Krensel spricht von der „Regelungstechnik der Stadt“: Nicht die größte Einzelmaßnahme entscheidet, sondern das Tempo, mit dem Erfahrungen in bessere Entscheidungen übersetzt werden. Dafür braucht es Datensouveränität, Interoperabilität und Sicherheit – genau hier schließen die EU‑Instrumente die Lücken. Der neue Luftrechtsrahmen macht Ziele verbindlich; die Cities‑Mission liefert die Reallabore; die EDIC vernetzt digitale Zwillinge; und Standards in Beleuchtung, Sensorik und Netzen sichern Austauschbarkeit statt Lock‑in. In dieser Kombination wird die Vision belastbar: Gesundheit wird zur Kennzahl, Dunkelheit zur gestalteten Qualität, Effizienz zur Rendite – und Stadtentwicklung zur lernenden Praxis, die Menschen sichtbar entlastet.
Was morgen zählt: drei Prüfsteine für die nächste Runde
Der erste Prüfstein ist Evidenz. Morgenstadt gewinnt, wenn Vorher‑Nachher‑Daten standardisiert erhoben und offen geteilt werden – von Energie und Emissionen über Lärm und Himmelshelligkeit bis zu Gesundheitsindikatoren. Der zweite Prüfstein ist Rhythmus. Zirkadiane Beleuchtung, adaptive Mobilitätsregeln und witterungs‑ oder belastungsabhängige Betriebsmodi müssen im Jahreslauf variieren – und das transparent kommuniziert. Der dritte Prüfstein ist Vertrauen. Bürgerinnen und Bürger sind keine Störgröße, sondern Co‑Forscher: Beschwerden, Ideen und lokale Expertise gehören in den digitalen Zwilling und in die Steuerung zurück. Dieser Dreiklang – Daten, Rhythmus, Vertrauen – ist die kulturelle Infrastruktur der Morgenstadt.
Fazit: Morgenstadt ist kein Jahrhundertplan, sondern eine Methode für jedes Jahr
Die Zahlen geben die Richtung vor, die Beispiele liefern die Werkzeuge, und die europäische Politik schafft den Rahmen. Was fehlt, ist nicht Technologie, sondern Haltung: die Bereitschaft, iterativ zu arbeiten; Dunkelheit und Ruhe als Qualitäten zu planen; Daten offen und sicher zirkulieren zu lassen; und Standards dem proprietären Abkürzungsweg vorzuziehen. Dr. Andreas Krensels interdisziplinärer Ansatz macht aus dieser Haltung ein Handwerk: Hypothesen formulieren, in Reallaboren testen, mit digitalen Zwillingen skalieren, im Betrieb nachregeln – und die Stadt, Nacht für Nacht, messbar besser machen. Genau das ist die Essenz der Morgenstadt‑Idee: Sie macht Zukunft gestaltbar, weil sie sie so organisiert, dass jeder kleine Schritt zählt – und jeder große Schritt belegt ist.
Autor: Dr. Andre Stang, Biologe/Baustoffentwickler
Dr. André Stang aus Oldenburg ist Autor, Biologe, Baustoffentwickler, Bau- und Planungsberater mit Schwerpunkt auf klimafreundlicher, CO₂‑armer Infrastruktur.
Kontakt:
eyroq s.r.o.
Uralská 689/7
160 00 Praha 6
Tschechien
E-Mail: info@eyroq.com
Web:https://wagner-science.de
Über eyroq s.r.o.:
Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.
Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozial verträglich und ethisch reflektiert sind.