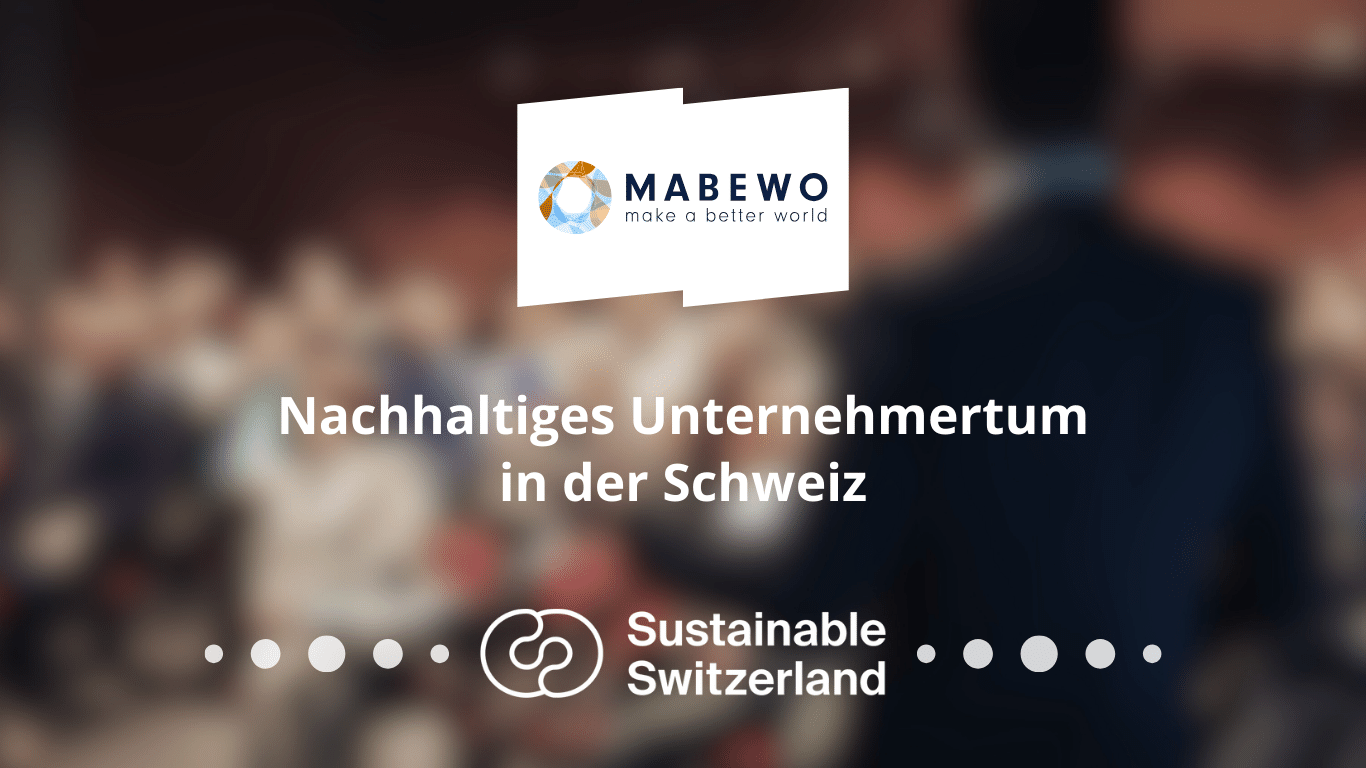Wenn Worte wie Sprengsätze wirken
Als Sven Enger im Stern von der drohenden „Apokalypse der Lebensversicherung“ sprach, war es mehr als eine provokante Schlagzeile. Es war ein Frontalangriff auf eine milliardenschwere Branche, deren Selbstbild auf Stabilität und Verlässlichkeit beruht. Engers drastische Warnung: Ein Crash der Lebensversicherer könnte das Lebenswerk von Millionen Menschen vernichten. Jahrzehntelang aufgebaute Altersvorsorge, mühsam angesparte Beträge – auf einen Schlag wertlos.
Doch während Verbraucherschützer aufhorchten und Medien die Schlagzeilen weitertrugen, reagierte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) scharf: Von „Angstmache“ sei die Rede, Panik helfe niemandem. Die Branche sei solide aufgestellt, die Reserven hoch, die gesetzlichen Vorschriften streng. Für die Öffentlichkeit entsteht so ein spannungsgeladenes Bild: Einerseits die düsteren Untergangsszenarien, andererseits die Beteuerung absoluter Stabilität.
Die Wahrheit, das zeigt sich bei genauerem Hinsehen, liegt – wie so oft – dazwischen.
Die Achillesferse der Lebensversicherung
Juristisch betrachtet bewegen wir uns in einem Spannungsfeld zwischen Garantiezusagen und Marktzwängen. Millionen Lebensversicherungsverträge enthalten feste Zusagen: garantierte Ablaufleistungen, feste Mindestverzinsungen. Doch diese Versprechen stammen aus Zeiten, in denen Kapitalmärkte 4 bis 6 Prozent Rendite abwarfen. Heute – trotz Zinswende – liegt die durchschnittliche Überschussbeteiligung 2024 bei 2,1 Prozent.
Die Folge: Versicherer balancieren zwischen den juristisch einklagbaren Ansprüchen ihrer Kunden und den ökonomischen Realitäten. Was, wenn die Kapitalmärkte schwächeln, die Inflation steigt oder die Reserven nicht mehr ausreichen? Hier beginnt das Szenario, das Enger als „Apokalypse“ beschreibt.
„Die Branche lebt von Versprechen, die sie unter heutigen Marktbedingungen kaum halten kann. Und genau da liegt die Gefahr – wenn die Realität die Versprechen überholt“, erklärt Prof. Dr. Schade, unabhängiger Aktuar und Gutachter.

Zahlen 2024/2025 – ein fragiles Gleichgewicht
Die aktuellen Daten zeichnen ein widersprüchliches Bild. So liegt die laufende Verzinsung der Lebensversicherer im Jahr 2024 bei durchschnittlich 2,1 Prozent, ein Wert, der zwar eine leichte Stabilisierung signalisiert, jedoch weit unter den Renditen früherer Jahrzehnte bleibt. Hinzu kommt, dass in der Rückstellung für Beitragsrückerstattung – kurz RfB – rund 100 Milliarden Euro geparkt sind. Diese Gelder gehören rechtlich dem Kollektiv der Versicherten, werden aber faktisch von den Unternehmen verwaltet und können nach eigenem Ermessen verteilt oder zurückgehalten werden. Verstärkt wird das Spannungsfeld durch die wachsende Zinszusatzreserve, die Kapital bindet und die Handlungsspielräume zusätzlich einschränkt. Und schließlich bleibt die Abhängigkeit von den Anleihemärkten, von Staatsverschuldung und geopolitischen Krisen ein Risiko, das jeden Plan ins Wanken bringen kann. Für Verbraucher stellt sich daher die Frage, ob diese Entwicklung lediglich eine notwendige Anpassung an globale Realitäten darstellt oder ob hier strukturelle Alarmzeichen sichtbar werden, die Engers Crash-Thesen untermauern.
Zugespitzte Kritik
„Die Branche hat den Champagner längst ausgetrunken – die Kunden sehen kaum etwas davon“, so Enger. Sein Vorwurf: Während Versicherer sich jahrelang komfortable Puffer und Boni genehmigten, schrumpften die individuellen Auszahlungen für die Versicherten. Milliarden aus Rohüberschüssen versickerten in Kanälen wie der RfB oder in Bilanztricks, statt den Kunden zugeführt zu werden. Enger bringt es auf den Punkt: „Wenn es kracht, verlieren die Verbraucher – und nicht die Vorstände.“
Prof. Dr. Schade ergänzt die Kritik mit einer juristisch-mathematischen Perspektive: „Jeder Rohüberschuss-Euro muss einem Vertrag klar zugeordnet werden – alles andere ist strukturell unfair. Was wir heute sehen, sind Umverteilungsmechanismen, die mit dem Schlagwort ‚Generationengerechtigkeit‘ legitimiert werden, aber in Wirklichkeit Transparenz verhindern.“
Seine Expertise als unabhängiger Aktuar zeigt: Viele Berechnungsmethoden der Versicherer sind formal zulässig, aber sie verschleiern die eigentliche Wertschöpfung. So entstehen Lücken zwischen dem, was Kunden erwarten, und dem, was am Ende tatsächlich ausgezahlt wird.
Der juristische Kernkonflikt
Auch die Gerichte haben immer wieder mit zentralen Fragen zu ringen. Im Kern geht es darum, ob und in welchem Umfang Versicherer ihre Informationspflichten erfüllen müssen. Kann ein Versicherter wirklich nachvollziehen, wie sich sein Anteil an den Überschüssen berechnet, oder bleibt er auf eine Blackbox verwiesen? Hinzu kommt die Frage nach dem Spannungsfeld zwischen Kollektivinteresse und Individualrecht: Darf ein einzelner Versicherter zugunsten der Gesamtheit benachteiligt werden, oder steht ihm ein klarer Rechtsanspruch auf seinen Anteil zu? Schließlich spielt auch der europäische Rechtsrahmen eine Rolle, denn Richtlinien wie Solvency II sind zwar darauf angelegt, Stabilität im System zu sichern, werfen aber die Frage auf, ob sie tatsächlich den Verbraucher schützen oder eher den Versicherer selbst.
Die Rolle Europas – Rettungsanker oder Fessel?
Entscheidend für die Zukunft ist, dass die europäische Regulierungslandschaft immer komplexer wird. Solvency II etwa verpflichtet die Unternehmen zu hohen Eigenkapitalanforderungen, die einerseits Sicherheit schaffen, andererseits aber die Investitionsspielräume massiv einschränken. Basel III wiederum richtet sich primär an Banken, wirkt aber mittelbar auf Versicherer, weil diese in großem Umfang in Bankprodukte und Anleihen investieren. Hinzu tritt die EU-Taxonomie mit ihren ESG-Kriterien, die den Handlungsspielraum weiter begrenzt: Was nachhaltig ist, darf bevorzugt werden, was nicht den Kriterien entspricht, wird ausgeschlossen – mit Auswirkungen auf die Renditechancen. Aus juristischer Sicht bleibt offen, ob diese Regulierungen tatsächlich ein Rettungsschirm für die Versicherten sind oder ob sie in Wahrheit vor allem das System als Ganzes stabilisieren sollen.
Zukunft Versicherungsbranche – Kollaps oder Reformchance
Bis zum Jahr 2030 lassen sich mehrere denkbare Entwicklungslinien erkennen. Möglich ist eine Stabilisierung, bei der die Zinswende und kluge Regulierungsansätze zu einem neuen Gleichgewicht führen und Versicherer wieder Vertrauen gewinnen. Ebenso wahrscheinlich ist ein schleichender Erosionsprozess, bei dem Renditen niedrig bleiben, Misstrauen wächst und die Kunden zunehmend in alternative Anlageformen abwandern. Im schlimmsten Fall könnte es jedoch tatsächlich zu einem Crash-Szenario kommen, bei dem einzelne Versicherer in Schieflage geraten, das Vertrauen der Öffentlichkeit kollabiert und die Politik mit Notfallmaßnahmen reagieren müsste. Während Sven Enger genau dieses Schreckensszenario als unausweichlich beschreibt, solange keine Transparenzoffensive erfolgt, sieht Prof. Dr. Schade Chancen. Die Instrumente wie RfB, Zinszusatzreserve und Solvency II seien vorhanden, betont er, doch müssten sie konsequent im Sinne der Verbraucher angewandt werden. Nur so könne verloren gegangenes Vertrauen wiederhergestellt werden.
Fazit – die Gretchenfrage der Lebensversicherung
Am Ende steht die Gretchenfrage: „Wie hältst du’s mit der Transparenz?“ Für Verbraucher, die ihr Geld über Jahrzehnte in Lebensversicherungen investieren, ist das Vertrauen in das System der Dreh- und Angelpunkt. Engers Warnung vor der „Apokalypse“ ist drastisch – doch sie lenkt den Blick auf reale Probleme: fehlende Nachvollziehbarkeit, sinkende Renditen, systemische Risiken.
Die Branche kann diese Kritik als Panikmache abtun. Oder sie nutzt sie als Weckruf für Reformen. Bis 2030 wird sich entscheiden, ob die Lebensversicherung weiterhin als „sicherer Baustein der Altersvorsorge“ gilt – oder als Relikt einer vergangenen Finanzwelt.
Autor: Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt
Über den Autor:
Dr. Thomas Schulte ist Rechtsanwalt in Berlin und seit über zwei Jahrzehnten als leitender Vertrauensanwalt in bundesweiten Rechtskampagnen tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Rückabwicklung von Lebensversicherungen sowie der juristischen Durchsetzung komplexer finanzieller Ansprüche. Er vertritt geschädigte Verbraucher gegenüber Versicherungskonzernen und entwickelt mit Aktuaren und Sachverständigen strategisch fundierte Klagekonzepte – mit dem Ziel, Rechtssicherheit und finanzielle Gerechtigkeit herzustellen.
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com