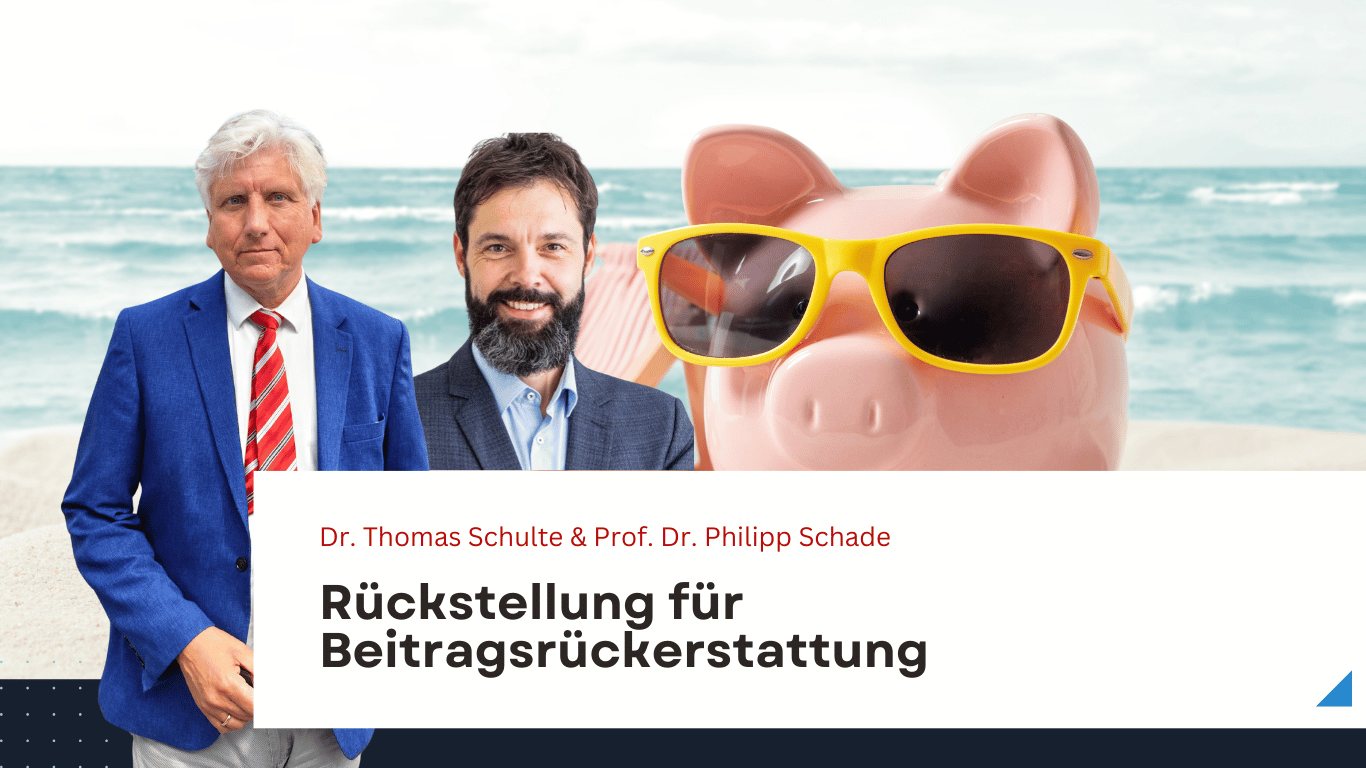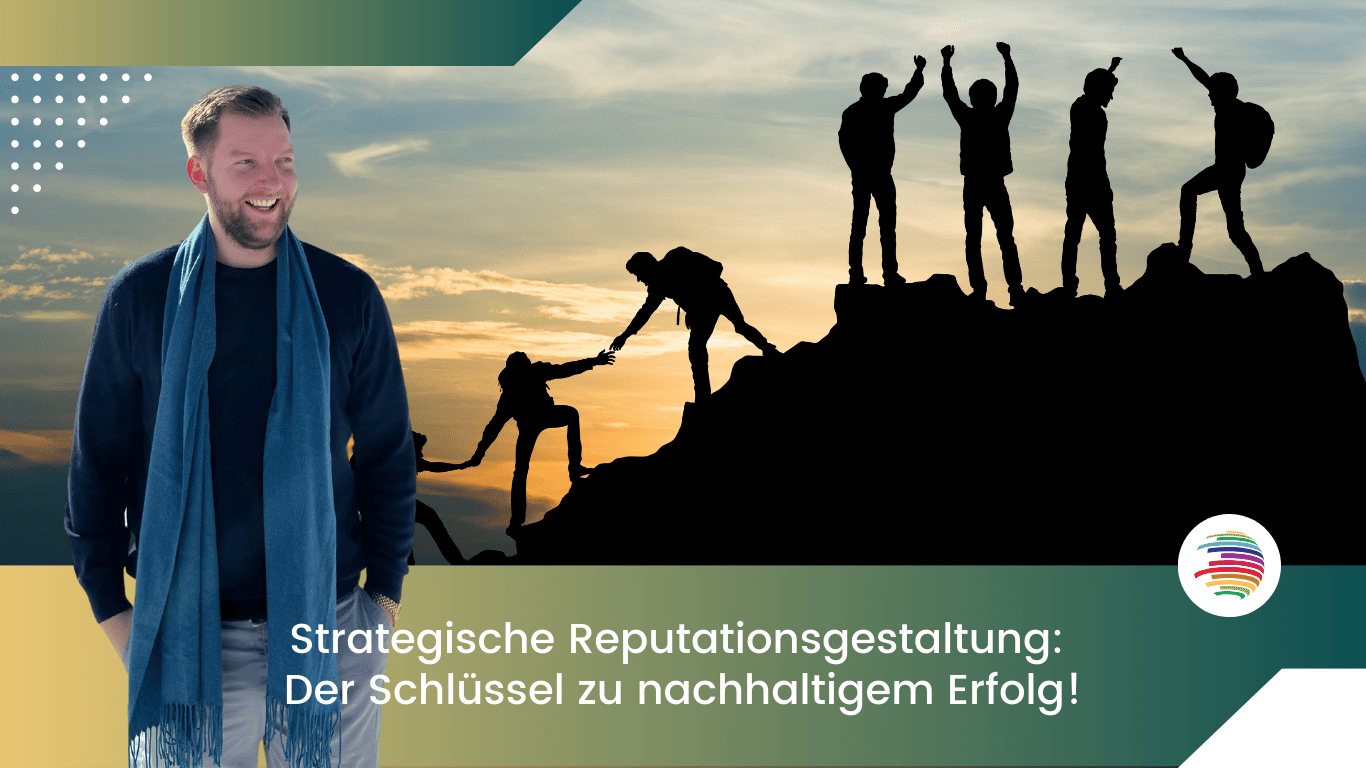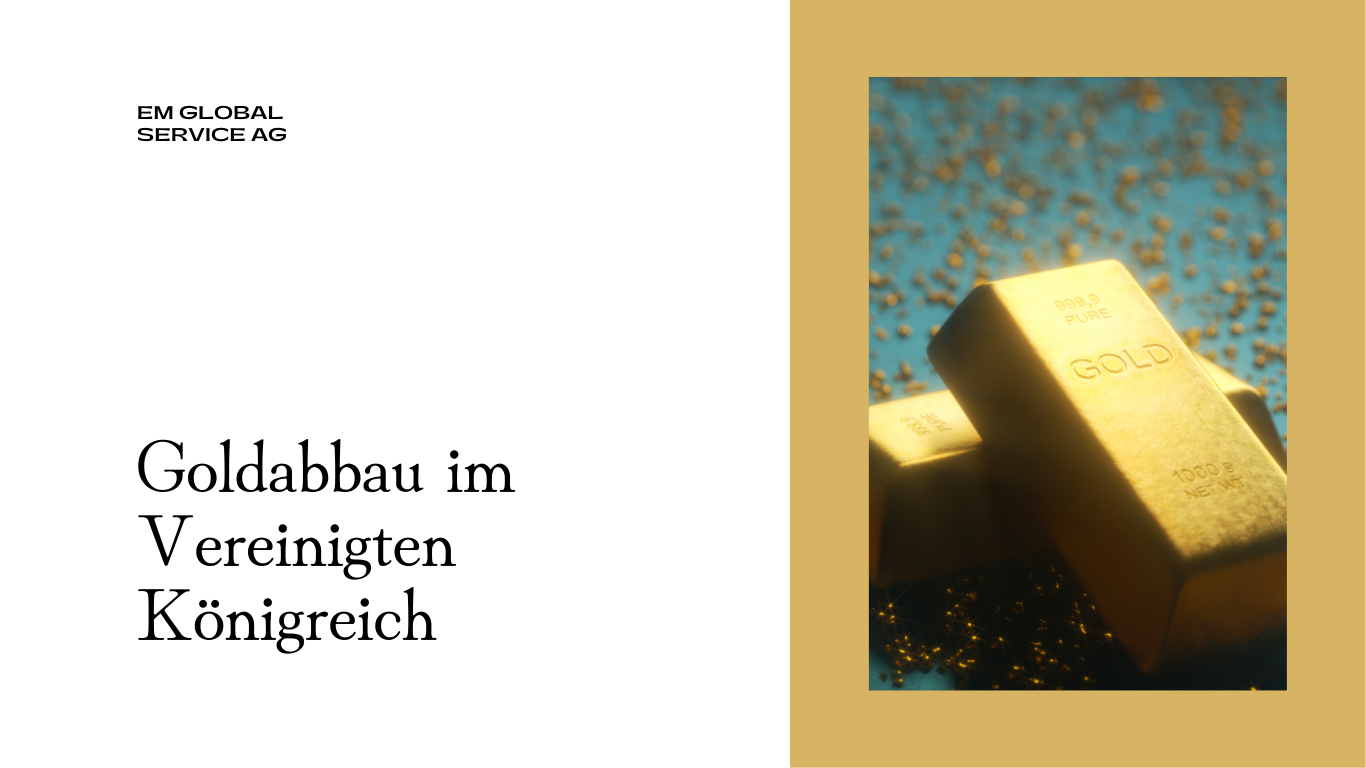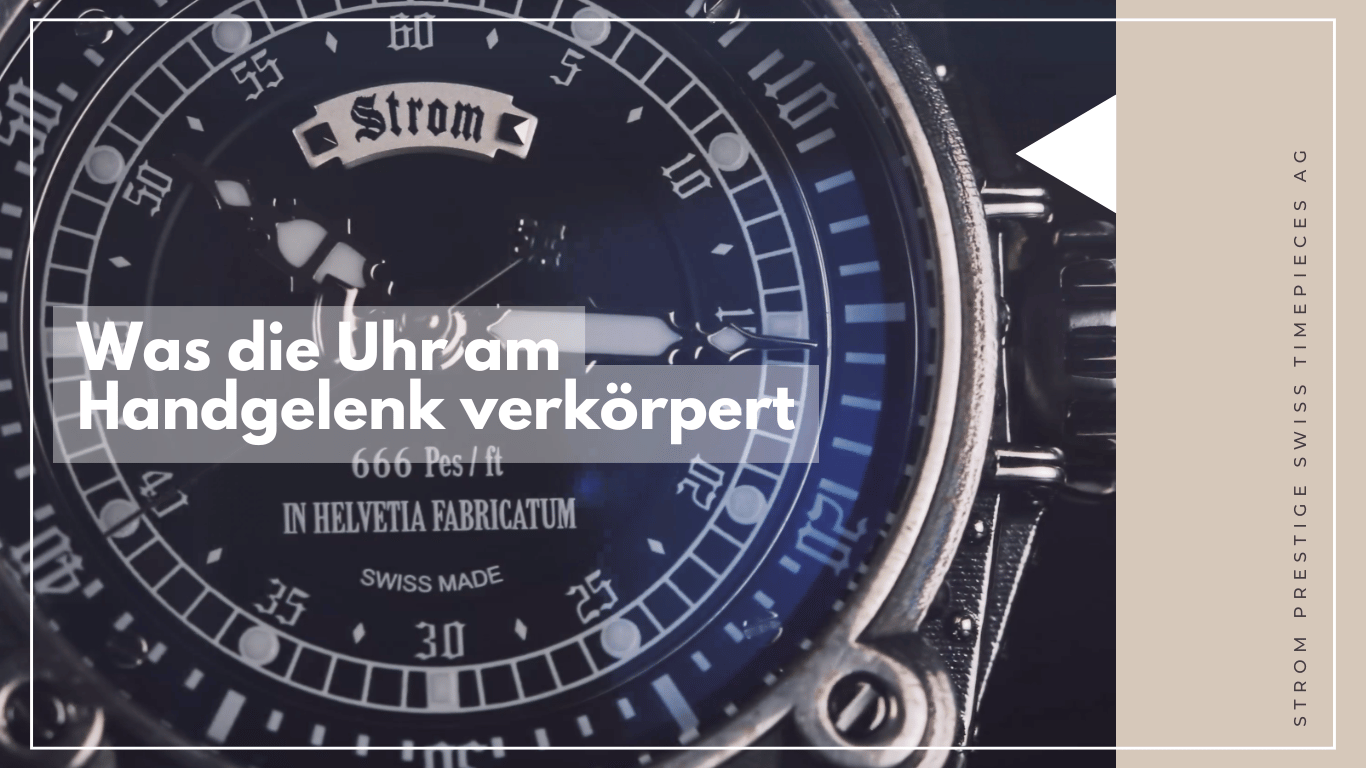Ein milliardenschweres Versprechen: Wem gehört die RfB eigentlich?
Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) ist einer der größten Unsicherheitsfaktoren in der deutschen Versicherungswirtschaft. Jahr für Jahr legen die Lebensversicherer Milliardenbeträge in dieser Position zurück – offiziell, um Kund:innen an künftigen Überschüssen zu beteiligen. Doch während die Unternehmen die RfB gerne als Sicherheitspuffer darstellen, fragen sich kritische Beobachter: Ist sie tatsächlich ein Sparschwein im Sinne der Versicherten – oder vielmehr eine Blackbox, die niemand von außen durchdringen kann?
Die Antwort ist komplex. Denn rechtlich betrachtet handelt es sich bei der RfB um „zweckgebundene Mittel“: Sie gehören wirtschaftlich den Versicherungsnehmer:innen, werden aber bilanziell vom Unternehmen verwaltet. Was nach Schutz klingt, ist in der Praxis ein Mechanismus, der Versicherern enorme Spielräume lässt.
Milliarden im Schatten: Die Dimensionen der RfB
Laut Zahlen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lag die RfB der deutschen Lebensversicherer 2024 bei über 80 Milliarden Euro. Das bedeutet: Jeder Versicherte hat – zumindest auf dem Papier – einen Anteil an diesem gigantischen Topf. Doch die entscheidende Frage lautet: Wann und in welchem Umfang werden diese Mittel tatsächlich ausgeschüttet?
Hier beginnt das Dilemma: Versicherer können frei entscheiden, wie sie die RfB nutzen. Sie dürfen Überschüsse zurückhalten, um „schwache Jahre“ abzufedern, sie dürfen Mittel umbuchen oder für sogenannte Zinszusatzreserven einsetzen. Die Folge: Kund:innen warten oft jahrelang auf eine Beteiligung – und viele erleben sie nie in voller Höhe.
Sven Enger, ehemaliger Versicherungsmanager und heutiger Branchenkritiker, bringt es auf den Punkt: „Die Branche hat den Champagner längst ausgetrunken – die Kunden sehen kaum etwas davon.“
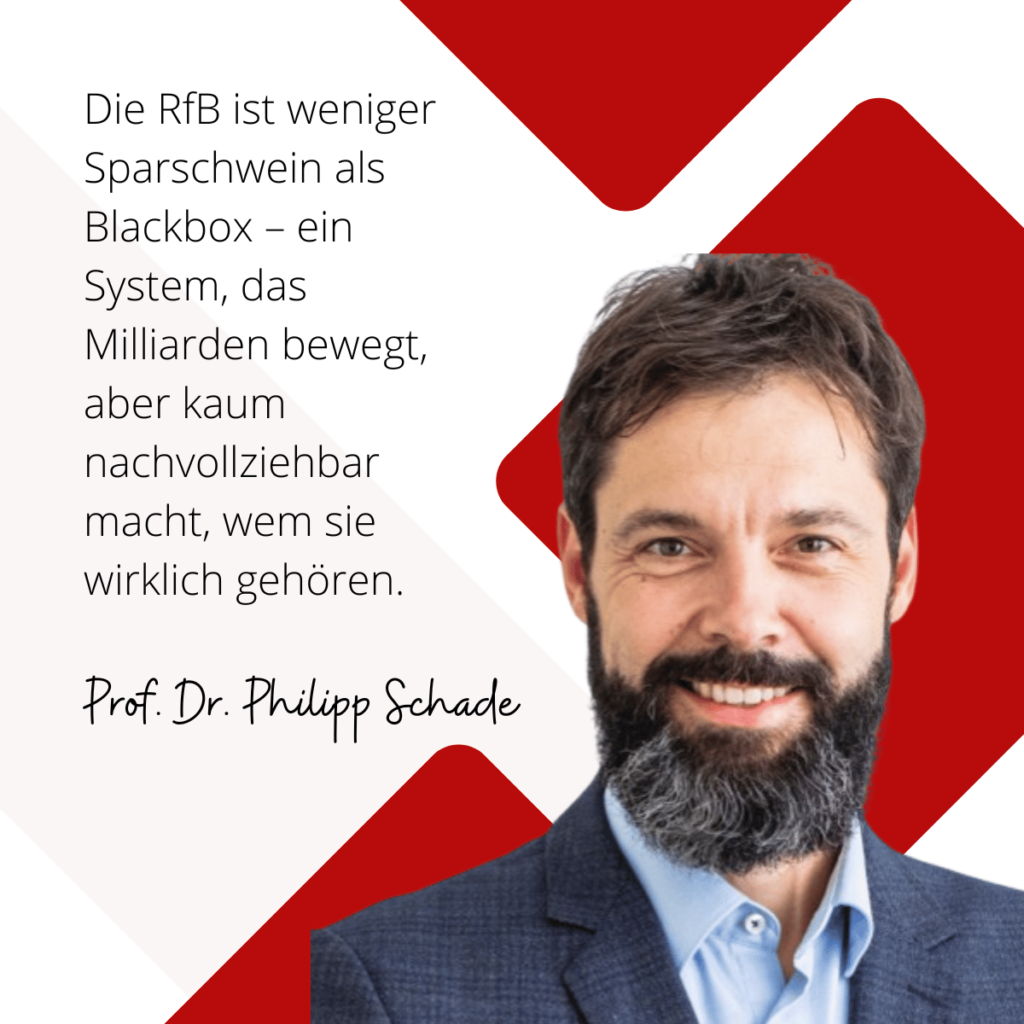
Das juristische Fundament: § 153 VVG und die Rechtsprechung
Juristisch ist die RfB eng mit § 153 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) verknüpft. Dort ist geregelt, dass Versicherungsnehmer:innen „angemessen“ an den Überschüssen beteiligt werden müssen. Doch was „angemessen“ heißt, bleibt schwammig. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zwar wiederholt betont, dass Versicherer transparent und nachvollziehbar erklären müssen, wie Überschüsse verteilt werden – aber in der Praxis bleiben viele Fragen offen.
Ein Beispiel: In mehreren Verfahren argumentierten Versicherer, dass die RfB als kollektiver Sicherheitspuffer nicht individuell einklagbar sei. Versicherungsnehmer könnten also nicht direkt verlangen, dass „ihr Anteil“ an der RfB ausgezahlt wird. Gerichte haben diese Sichtweise bislang gestützt – und damit die RfB zur juristischen Blackbox gemacht.
Praxisbeispiel: Der verschwundene Überschuss
Ein Verbraucher hatte über 25 Jahre eine Lebensversicherung mit einer garantierten Verzinsung von 3,25 Prozent abgeschlossen. Als er seine Police kündigte, stellte er fest, dass die erwarteten Überschüsse weit unter den Prognosen lagen. Auf Nachfrage verwies der Versicherer auf die RfB – dort seien die Mittel geparkt, aber derzeit nicht ausschüttbar.
Der Fall landete vor Gericht. Der Kläger argumentierte, die Mittel gehörten ihm zumindest anteilig und dürften nicht dauerhaft blockiert werden. Das Gericht jedoch folgte der Argumentation des Versicherers: Die RfB sei ein kollektiver Puffer, kein individuelles Sparbuch. Ergebnis: Der Verbraucher ging leer aus.
Kritik der Experten: Intransparenz und strukturelle Defizite
Versicherungsexperten wie Prof. Dr. Schade kritisieren seit Jahren, dass die RfB ein Instrument zur Verschleierung ist. Überschüsse, die eigentlich an Kunden fließen müssten, würden auf unbestimmte Zeit im „System“ gehalten. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung sei damit weniger ein Garant für Sicherheit als ein „Katalysator für Intransparenz“.
Auch die europäische Perspektive verschärft den Druck: Mit Solvency II wurde die Pflicht zur Bildung von Eigenmitteln verschärft, gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten geschaffen, die RfB als „Eigenkapitalersatz“ darzustellen. Kritiker sprechen von einer „Doppelverwendung“: Einerseits gehört die RfB den Kunden, andererseits stärkt sie die Kapitalbasis der Versicherer.

Wissenschaftlich fragend: Ist die RfB ein Fremdkörper im Rechtsstaat?
Die spannende Frage lautet: Wie lange wird die RfB in ihrer heutigen Form noch bestehen können? Juristisch gesehen ist sie ein Konstrukt aus einer anderen Zeit – aus einer Ära, in der Versicherer paternalistisch über die Gelder ihrer Kunden wachten. Heute jedoch, in Zeiten von Verbraucherrechten, Transparenzgeboten und EU-Finanzmarktrichtlinien, wirkt die RfB wie ein Fremdkörper.
Sollte nicht jeder Versicherte das Recht haben, seinen individuellen Anteil am Überschuss einzufordern – und zwar unabhängig davon, welche Strategie der Versicherer mit seinen Milliarden verfolgt?
Ausblick: Zwischen Vertrauen, Regulierung und der Suche nach Transparenz
Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob die Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) ein Bollwerk der Intransparenz bleibt oder ob sie sich zu einem Instrument echter Kundenbeteiligung wandelt. Denn die Welt der Finanzmärkte und der Versicherungen verändert sich rasant – getrieben von politischen Vorgaben, EU-Richtlinien und einem immer lauteren Ruf nach Fairness. Spätestens bis 2030 wird sich die Frage stellen, ob Versicherer weiterhin Milliarden im Schatten ihrer Bilanzen parken dürfen, ohne dass die Versicherten einen klaren Anspruch darauf haben.
Schon heute fordern Verbraucherschützer, dass die RfB nicht länger als „eigene Reserve“ der Unternehmen interpretiert werden darf, sondern endlich als das, was sie im Kern sein soll: ein kollektives Guthaben der Versicherten. Doch wie könnte eine solche Wende aussehen? Würde eine gesetzliche Verpflichtung zur zeitnahen Ausschüttung von RfB-Mitteln das Vertrauen in die Lebensversicherungen zurückbringen – oder die Stabilität der Unternehmen gefährden?
Die EU-Richtlinien Basel III und Solvency II erhöhen bereits den Druck. Sie verlangen von Versicherern, ihre Eigenmittel zu stärken und Risiken transparenter auszuweisen. Gleichzeitig aber erlauben sie es, die RfB bilanziell als Eigenkapitalersatz zu nutzen. Kann man von einer echten Kundenzugehörigkeit sprechen, wenn ein Mittel gleichzeitig die Stabilität der Unternehmensbilanz verbessert? Oder ist das nicht vielmehr ein juristischer Spagat, der auf Dauer nicht haltbar ist?
Auch die Renditeerwartungen werfen Fragen auf: Wenn die klassischen Überschüsse weiter sinken, wie können Versicherer den Versicherten überhaupt noch eine angemessene Beteiligung versprechen? Reichen die Mechanismen der RfB, um auch in einer Niedrigzinswelt oder unter volatilen Kapitalmärkten Stabilität zu garantieren? Oder wird am Ende die RfB selbst zum Beweis dafür, dass das Modell der Lebensversicherung in seiner bisherigen Form an ein Ende gekommen ist?
Bis 2030 werden sich deshalb mehrere Weichenstellungen entscheiden: Wird der Gesetzgeber die Rechte der Versicherten stärken und ihnen ein individuelles Zugriffsrecht auf die RfB einräumen? Werden Gerichte beginnen, den „kollektiven Charakter“ infrage zu stellen und die RfB transparenter zu machen? Oder bleibt sie eine juristisch abgeschottete Blackbox, deren Mechanismen nur wenige Eingeweihte verstehen?
Für die Versicherten ist dies keine akademische Frage, sondern eine sehr reale: Es geht um Milliarden, die über Jahrzehnte angespart wurden, um Sicherheit im Alter zu schaffen. Werden diese Gelder irgendwann sichtbar zurückfließen – oder bleiben sie ein unsichtbares Polster, mit dem die Versicherungswirtschaft ihre eigene Stabilität finanziert? Die Antwort darauf wird nicht nur über Vertrauen oder Misstrauen entscheiden, sondern über die Zukunftsfähigkeit eines ganzen Systems.
V.i.S.d.P
Dr. Rainer Schreiber
Dozent, Erwachsenenbildung & Personalberater
Über den Autor:
Personalberater und Honorardozent Dr. Rainer Schreiber, mit Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzierung, Controlling, Personal- und Ausbildungswesen. Der Blog schreiber-bildung.de bietet Themen rund um Bildung, Weiterbildung und Karrierechancen. Sein Interesse liegt in der beruflichen Erwachsenenbildung und er publiziert zum Thema Personalberatung, demografischer Wandel und Wirtschaftspolitik.
Kontakt
Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte
E-Mail: law@meet-an-expert.com
Pressekontakt
ABOWI UAB
Naugarduko g. 3-401
03231 Vilnius
Litauen
Telefon: +370 (5) 214 3426
E-Mail: contact@abowi.com
Internet: www.abowi.com