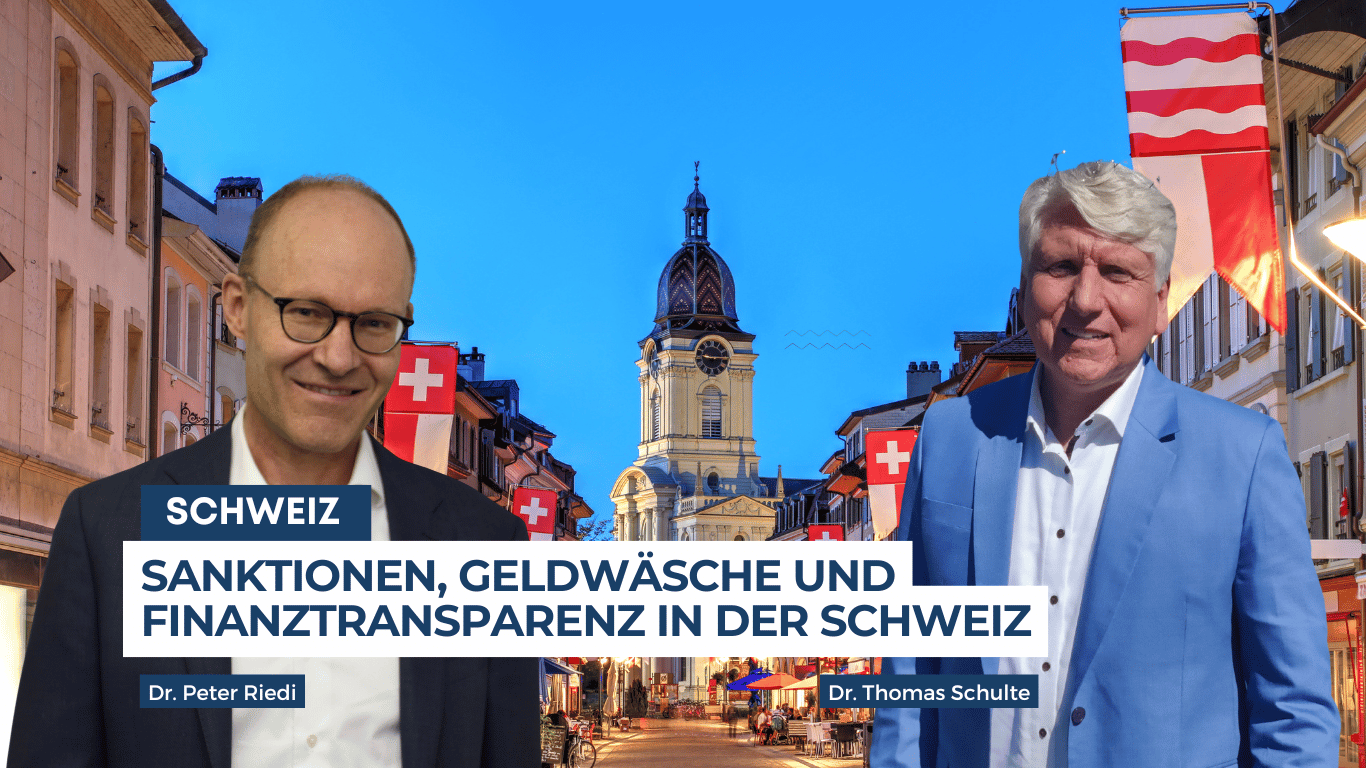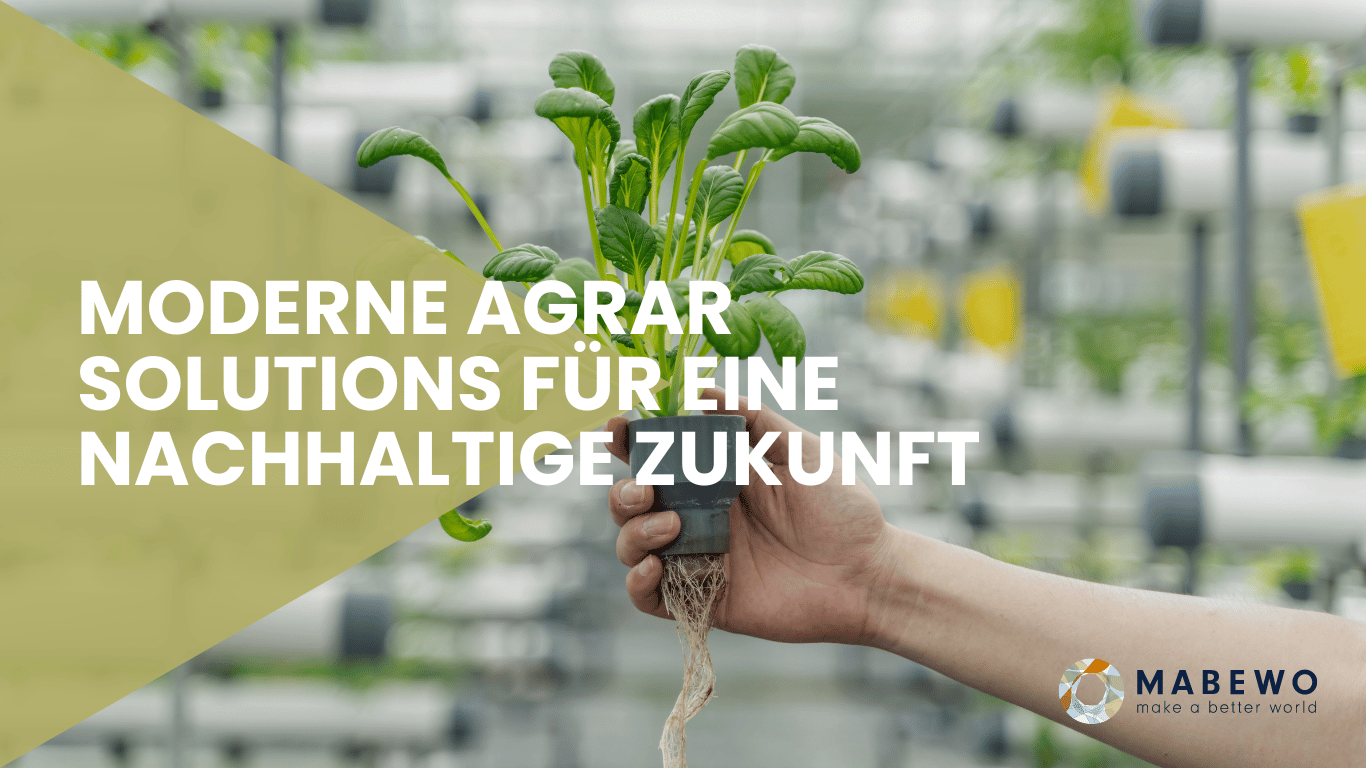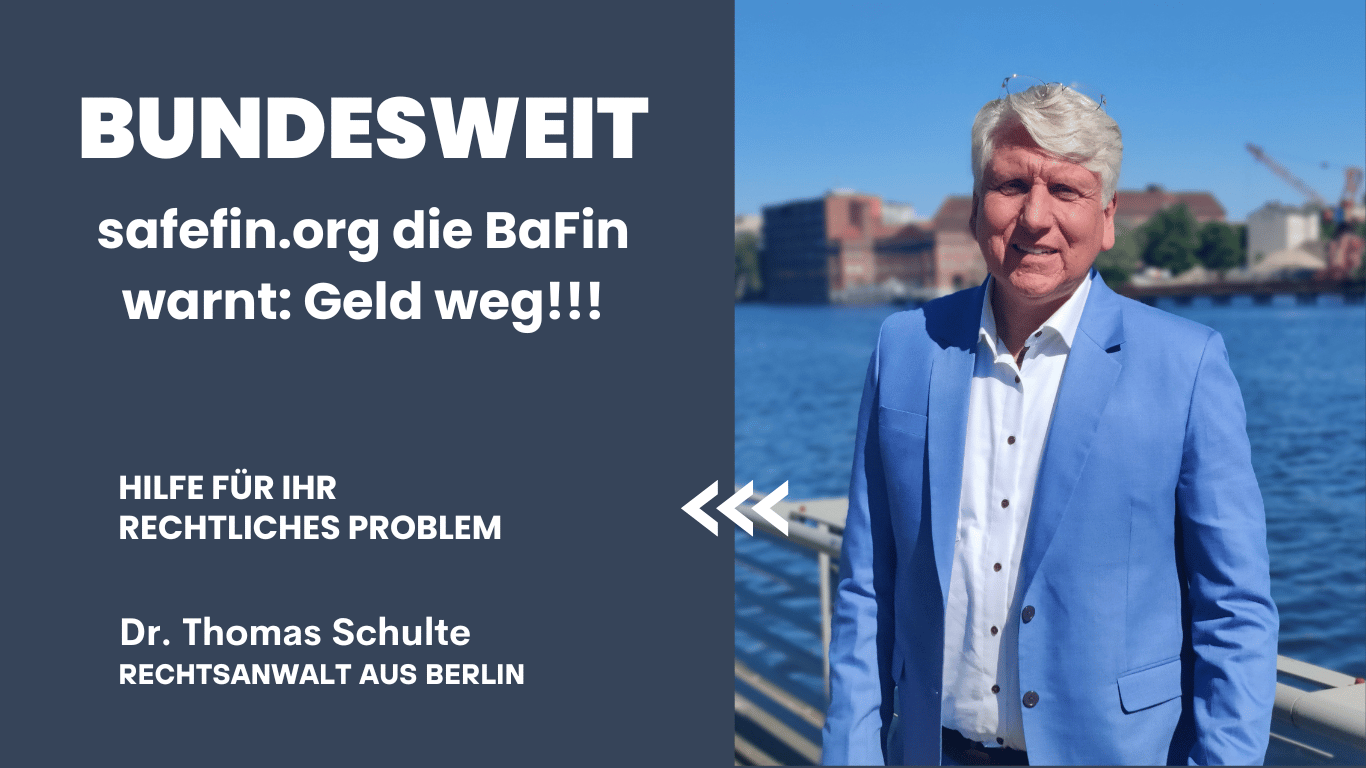Ein Blick auf die jüngste Anpassung der Syrien-Verordnung aus juristischer Sicht von Dr. Thomas Schulte, Berlin und ökonomischer Sicht von Dr. Peter Riedi, Fürstentum Liechtenstein.
Die Vermögen internationaler politisch exponierter Personen geraten seit Jahren immer stärker in das Visier der Gesetzgeber. Besonders wenn Repression, Korruption und illegitime Bereicherung im Spiel sind, greifen Staaten weltweit zunehmend zu Maßnahmen zur Identifikation, Sperrung und Rücküberweisung unrechtmäßig erworbener Gelder. So hat auch die Schweizer Regierung am 31. Juli 2025 eine bedeutende Änderung vorgenommen, die insbesondere für Finanzintermediäre und andere im Finanzdienstleistungssektor tätige Akteure große rechtliche Bedeutung hat.
Die Rede ist von der Anpassung des Anhangs der Verordnung über die Sperrung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Syrien, kurz: Syrien-Verordnung (SR 196.127.27). Diese Änderung stützt sich auf Artikel 5 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, auch bekannt als SRVG (SR 196.1). Juristen und Experten im europäischen Finanzmarktrecht begrüßen diesen Schritt. Im Folgenden werden juristische und politische Hintergründe sowie praktische Auswirkungen der Maßnahme beleuchtet.
Ergänzende Perspektive von Dr. Peter Riedi – Liechtenstein und die Schweiz im Spannungsfeld von Finanztransparenz und Stabilität
Während Dr. Schulte die juristische Dimension herausarbeitet, lenkt Dr. Peter Riedi, Volkswirt aus dem Fürstentum Liechtenstein, den Blick auf die ökonomischen und systemischen Implikationen: „Die Schweiz und Liechtenstein haben sich in den vergangenen Jahren von reinen Vermögensverwaltungsstandorten hin zu transparenten und international vernetzten Finanzsystemen entwickelt. Doch dieser Wandel hat einen Preis: Die Balance zwischen Diskretion, die traditionell geschätzt wird, und der Pflicht zur Offenlegung im Rahmen internationaler Sanktionen wird zunehmend schwieriger.“
Riedi verweist auf Zahlen: In Liechtenstein bestehen trotz der kleinen Größe über 4.000 Stiftungen und Trusts, die Vermögen in Milliardenhöhe verwalten. Für sie gilt seit den Reformen der letzten Jahre eine der strengsten Sorgfaltspflichten Europas. „Wer glaubt, Liechtenstein sei ein Schlupfloch, irrt gewaltig. Heute ist das Land ein Prüfstein für die Frage, ob ein kleiner Finanzplatz die Anforderungen globaler Transparenz und zugleich die Bedürfnisse internationaler Anleger in Einklang bringen kann.“
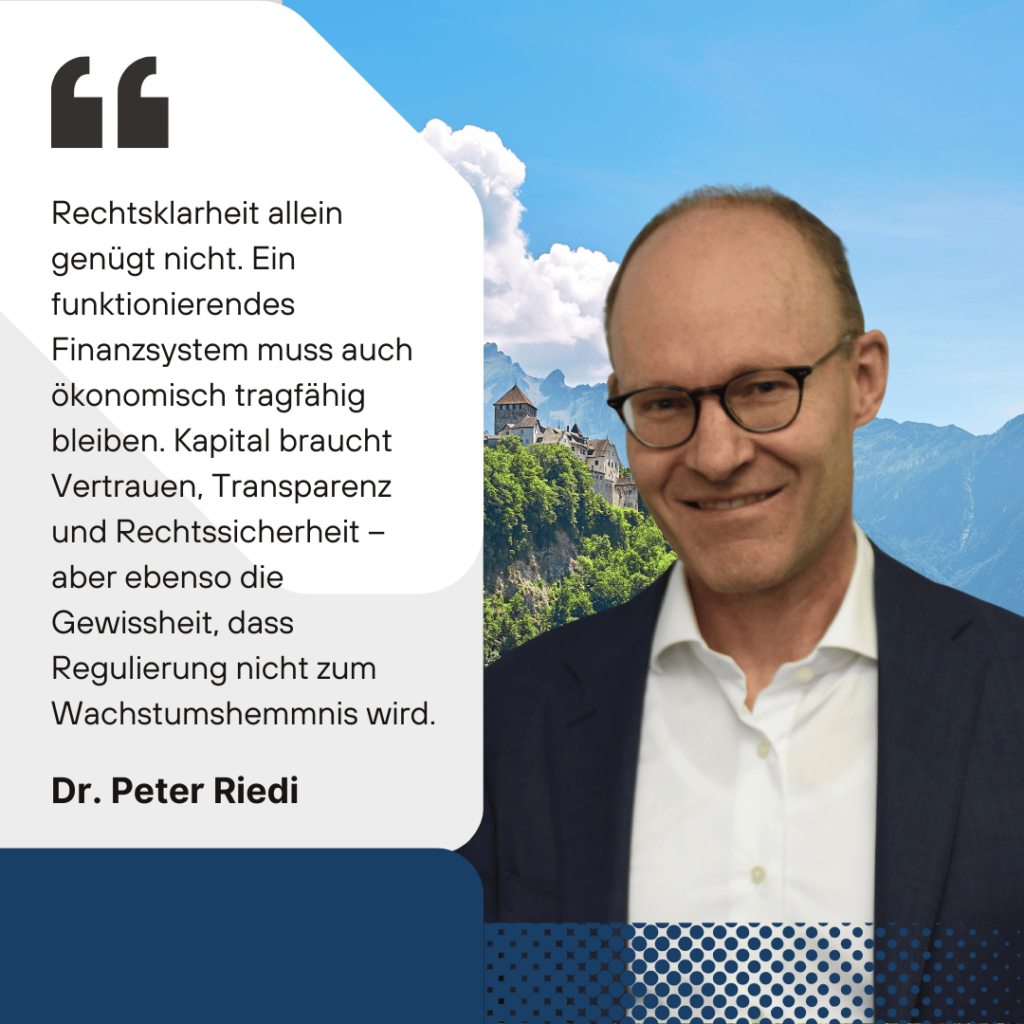
Wozu dient die Syrien-Verordnung rechtlich?
Die Syrien-Verordnung ist Teil eines umfassenderen Gefüges von Maßnahmen, die die Schweiz insbesondere im Hinblick auf Sanktionen und internationale Verpflichtungen erlässt. Diese Verordnungen dienen dazu, UN-Sicherheitsratsresolutionen sowie Beschlüsse der EU und anderer internationaler Organisationen wirksam und rechtsverbindlich umzusetzen. Sie zielen darauf ab, Druck auf Regime auszuüben, die ihre politischen oder wirtschaftlichen Positionen durch Menschenrechtsverletzungen oder die Aushöhlung des Rechtsstaates sichern wollen.
Im Fall Syriens konzentrieren sich die Maßnahmen auf politisch exponierte Personen (sogenannte PEPs) sowie mit diesen verbundene Unternehmen und Organisationen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass Vermögenswerte aus unrechtmäßigen Quellen stammen oder zur weiteren Repression der Bevölkerung genutzt werden könnten.
„Die Schweiz übernimmt mit dem SRVG eine Vorreiterrolle im internationalen Kampf um Finanztransparenz und Rechtsstaatlichkeit“, erklärt Dr. Thomas Schulte aus Berlin. „Besonders bemerkenswert ist, wie detailliert und klar das Regelwerk ausgestaltet ist. Die rechtliche Umsetzung ist nachvollziehbar und folgt einem funktional gezielten Regelungsansatz.“
Rechtliche Grundlage: SRVG und Art. 3
Zentral für die aktuelle Thematik ist Artikel 3 des SRVG. Dort heißt es:
„Personen und Institutionen, die in der Schweiz Vermögenswerte halten oder verwalten oder davon Kenntnis haben, dass sich solche Vermögenswerte auf dem Staatsgebiet befinden, müssen diese Vermögenswerte unverzüglich sperren, sobald eine entsprechende Maßnahme nach Artikel 2 des Gesetzes vorliegt.“
Diese Verpflichtung trifft insbesondere sogenannte Finanzintermediäre. Dazu zählen Banken, Vermögensverwalter, Treuhänder, Anwälte mit Mandaten im Bereich der Vermögensverwaltung und auch Versicherer. Kurz gesagt: Jeder Marktteilnehmer, der Zugang zu Finanzmitteln und deren Bewegungen hat, steht nun in erhöhtem Maß in der Pflicht.
Was bedeutet „unverzüglich“ in der Praxis?
Ein interessantes juristisches Detail, auf das ich als erfahrener Rechtsanwalt immer wieder hinweise, ist die juristische Auslegung des Wortes „unverzüglich“. Gemäß gängiger Auslegung des Schweizer sowie auch deutschen Rechts bedeutet dies: ohne schuldhaftes Zögern. In der Praxis heißt das, dass betroffene Vermögenswerte augenblicklich gesperrt werden müssen, sobald ein entsprechender Verdacht oder Hinweis besteht.
Wird diese Frist nicht eingehalten, drohen empfindliche Sanktionen. Hinzu tritt die Pflicht zur Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei, kurz MROS – ein wichtiges Organ zur Bekämpfung von Geldwäsche unter der Aufsicht des Bundesamts für Polizei (fedpol).
Ein multidimensionales Zusammenspiel zwischen Völkerrecht, Finanzrecht und Compliance
Heutzutage ist kaum ein Bereich des Finanzmarktrechts nicht in einer Weise durch internationales Recht beeinflusst. Das betrifft sowohl Primärverpflichtungen als auch sekundäre Mechanismen zur Einhaltung von Regeln und Kontrolle von Personen und Vermögen, gerade wenn ausländische politische Exponiertheit (PEP) im Raum steht.
Was vielen Unternehmen nicht bewusst ist: Schon die fahrlässige Verletzung solcher Pflichten kann erhebliche rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Compliance-Abteilungen in Banken und Kanzleien sind damit in der Pflicht, die neue Fassung der Syrien-Verordnung detailliert aufzunehmen und in operativen Geschäftsanwendungen zu implementieren.
„Internationale Finanzethik und rechtsstaatliche Prinzipien sind keine Gegensätze mehr, sondern fester Bestandteil jeder Due-Diligence-Prüfung erfolgreicher internationaler Kanzleien und Finanzdienstleister“, so Dr. Schulte weiter.
Wirtschaftliche Fragestellung: Hemmt Transparenz das Wachstum?
Riedi stellt provokant die Frage, ob übermäßige Regulierung langfristig nicht auch die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Finanzplätze gefährdet. „Ja, wir benötigen Regeln, um Missbrauch und Geldwäsche zu verhindern. Aber wir müssen uns auch fragen, ob eine Finanzarchitektur, die allein auf Verdachtsmeldungen und Blockaden setzt, nicht das Vertrauen ehrlicher Marktteilnehmer untergräbt. Kapital ist scheu – es sucht Stabilität, Rechtssicherheit und faire Behandlung. Wenn Anleger das Gefühl haben, dass sie permanent unter Generalverdacht stehen, werden sie andere Wege finden.“

Die Rolle von MROS – eine Behörde mit zunehmender Stärke
Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS wurde über die Jahre hinweg zu einem schlagkräftigen Organ. Ihre Rolle besteht nicht nur in der Entgegennahme von verdächtigen Aktivitäten. Vielmehr fungiert sie als zentrale Schnittstelle zwischen Finanzintermediären, den Strafverfolgungsbehörden und internationalen Partnerdiensten.
Hier spielt auch die Qualität der Meldung eine entscheidende Rolle. Es genügt nicht, einfach einen bloßen Hinweis zu geben. Vielmehr muss der Melder, z. B. eine Bank, sorgfältig dokumentieren und darlegen, warum aus ihrer Sicht eine Verbindung zwischen den Vermögenswerten und einer in der Liste geführten Person oder Organisation besteht. Dieser Schritt erfordert sowohl juristische Fachkunde als auch betriebswirtschaftliches Verständnis.
Die Schweizer und Liechtensteiner Lektion für Europa
Gerade in der Schweiz zeigt sich nach Riedis Analyse ein neues Selbstverständnis: Statt einseitig auf Bankgeheimnis und Verschwiegenheit zu pochen, etabliert sich eine Kultur der „aktiven Transparenz“. Banken investieren massiv in Compliance-Technologien, KI-gestützte Prüfungen und internationale Kooperation. „Das könnte ein Modell für Europa sein: nicht defensive Anpassung an Druck von außen, sondern proaktive Gestaltung einer neuen Finanzethik.“
Liechtenstein geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Als Kleinstaat mit internationaler Strahlkraft nutzt es seine Flexibilität, um besonders schnell auf regulatorische Anforderungen zu reagieren. „Liechtenstein hat mit dem Asset Recovery Framework eine Art Blaupause entwickelt, wie man unrechtmäßige Gelder effektiv einfriert, ohne legitime Vermögensträger zu kriminalisieren“, betont Riedi.
Verantwortung lässt sich nicht outsourcen
Ein typisches Missverständnis im Bereich der Geldwäschereibekämpfung ist die Annahme, man könne die Verantwortung an externe Dienstleister delegieren. Gerade in mittelständischen Familienunternehmen oder bei kleineren Vermögensverwaltern ist es üblich, Compliance-Aufgaben partiell auszulagern. Doch das Gesetz spricht eine klar andere Sprache. Die Pflicht zur unmittelbaren Sperrung sowie zur Meldung hat die juristische Person beziehungsweise deren Leitung selbst wahrzunehmen.
Dr. Schulte betont: „Hier zeigt sich der Charakter des SRVG als echtes Verantwortungsgesetz. Wer Vermögen verwaltet, muss seine Pflichten kennen – In dubio pro diligentia.“
Sanktionen und Diskretion sind kein Widerspruch
Ein weiteres bemerkenswertes Thema, das häufig in Gesprächen mit Mandanten aufkommt, ist der vermeintliche Interessenkonflikt zwischen Diskretionspflichten – etwa dem Bankgeheimnis – und internationaler Sanktionsgesetzgebung. Tatsächlich haben aber schweizerische sowie deutsche Gerichte in den letzten Jahren klargestellt, dass der Schutz vor Rechtsmissbrauch und Repression Vorrang hat.
So wurde beispielsweise in etlichen Verfahren deutlich gemacht, dass „das Bankgeheimnis nicht als Schutzinstrument für verfolgte Diktatoren dienen darf.“ Die Pflicht zur Offenlegung bei Geldwäscheverdachtsmeldungen sticht damit die Verschwiegenheitspflicht aus.
Perspektiven für die internationale Zusammenarbeit
In einer Welt, in der Grenzen in digitaler Sekundenschnelle überschritten werden können, ist das SRVG ein Ausdruck grenzüberschreitenden Normwillens. Staaten wie die Schweiz zeigen mehr und mehr Bereitschaft, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, auch wenn dies in der Vergangenheit teilweise noch zurückhaltender gehandhabt wurde.
Diese Offenheit, unterstützt durch Gesetze wie das SRVG, ist essentiell für eine gerechte Weltordnung und den Schutz von Gesellschaften vor der Machtwillkür korrupter Eliten.
Ein Appell an Verantwortung und Rechtsklarheit
Die nun erfolgte Anpassung der Syrien-Verordnung am 31. Juli 2025 ist damit mehr als nur eine formale Maßnahme. Sie ist Ausdruck eines klaren politischen Willens, unrechtmäßige Bereicherung und fragile Finanzstrukturen nicht länger zu dulden.
Banken, Notare, Anwälte, Treuhänder und Versicherer sind jetzt gefordert, ihre Systeme anzupassen und Prozesse zu verschärfen. Das Verständnis der regulatorisch-juristischen Verantwortung ist zwingend notwendig für den Schutz nationaler und internationaler Stabilität.
Gesellschaftliche Dimension – angstfreies Wirtschaften
Für beide Experten bleibt das Ziel dasselbe: eine Gesellschaft, die ohne Angst am wirtschaftlichen Leben teilhaben kann. Dr. Schulte stellt die rechtliche Klarheit in den Vordergrund, während Dr. Riedi die wirtschaftliche Tragfähigkeit thematisiert. Zusammen ergibt sich eine zentrale Frage für die Zukunft: Wie schaffen wir ein Finanzsystem, das kriminelle Strukturen wirksam ausschließt, ohne die ehrlichen Teilnehmer durch Überregulierung abzuschrecken?
Doppel-Fazit – Recht und Wirtschaft im Gleichklang
Dr. Thomas Schulte, Berlin, zieht ein klares juristisches Resümee: „Die Anpassung der Syrien-Verordnung ist ein starkes Signal. Sie zwingt Finanzintermediäre, Verantwortung zu übernehmen, und macht deutlich: Rechtliche Pflichten dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wer Vermögen verwaltet, trägt unmittelbare Verantwortung – im Zweifel pro Diligentia.“
Dr. Peter Riedi, Volkswirt aus Liechtenstein, ergänzt die ökonomische Dimension: „Rechtsklarheit allein genügt nicht. Ein Finanzsystem muss auch ökonomisch tragfähig bleiben. Kapital benötigt Vertrauen, Transparenz und Rechtssicherheit – aber ebenso die Gewissheit, dass Regulierung nicht zum Wachstumshemmnis wird. Nur wenn wir Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit ausbalancieren, bleibt Europa ein starker Finanzstandort.“
Beide Perspektiven zusammen eröffnen den Weg zu einer neuen Finanzarchitektur: juristisch klar, ökonomisch tragfähig und gesellschaftlich zukunftsfähig – ein Finanzsystem, das Kriminalität ausschließt, aber ehrlichen Marktteilnehmern Freiräume zur Entfaltung lässt.
Autor: Maximilian Bausch, B.Sc. Wirtschaftsingenieur
Maximilian Bausch ist Wirtschaftsingenieur, Autor und Blogger. Er schreibt über Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie – faktenbasiert, verständlich und zukunftsorientiert.